










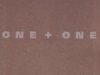




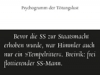
 Klaus
Klaus „Das All im Ball“
Text des Vortrags aus Weimar.
Klaus Theweleit; Weimar, 29. März 2015
„Das All im Ball“.
Mit Wörtern spielen, mit Bällen spielen, Krieg spielen. Fußballextreme.
„Können wir das All nicht bewegen
bewegen wir doch den Ball“. (Vergil/Freud)
Prämisse 1: Realität und Spiel.
Mit der Formel »Fussball als Realitätsmodell« will ich sagen, dass man das, was man für die Welt hält – seine eigene Welt und die äußere – von vielen Punkten her begreifen kann. Vorausgesetzt, man kennt sich in dem Bereich, von dem man startet, bestens aus. Bestimmte Parameter, die beispielsweise in der Arbeitswelt auftauchen, wie Vorschrift und Befolgung, Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, Aufmerksamkeit für Neuerungen etc., finden sich ebenso im Fußball: Führungsspieler, Wasserträger, strategische Unterordnung, »Kameradschaft«, Trainer-Befehlsgewalt oder gar »Truppe«.
Solche Ähnlichkeiten sind nicht bloße Analogien, sondern wirkliche Parallelen, parallele Organisationsstrukturen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Wer sich in der Organisation einer Behörde, eines Industriebetriebs, einer Universität oder in den Pop-Kultur Diversitäten wirklich gut auskennt, oder aber wer sich im Universum Fußball wirklich gut auskennt – alle, die ihren Bereich durchlebt und durchdacht haben – kennen auch die anderen Organisationen, kennen damit die wirksamen Strukturen ihrer Gesellschaft. Sie können mit dem, was sie in ihren jeweiligen Bereichen gelernt haben, ohne weiteres in den anderen Bereichen arbeiten.
Mit dem Wort »Modell« arbeitet man in einer Spielwelt. Das Spiel kann so, oder auch anders, verlaufen. Zu einem Verständnis der Wechselfälle einer Gesellschaft gelangt man überhaupt nur über den Pol »Spiel«. Wenn Gesellschaften sich verändern, verschieben oder auch, wenn etwas im »Privaten« sich entscheidend verändert, hat das immer etwas Experimentelles und, wenn es glücklich verläuft, Spielerisches an sich. Veränderndes Denken speist sich immer auch vom Spielerischen, ohne das es die Fähigkeit zur Utopie nicht gäbe.
Prämisse 2: Gewaltabfuhr
Alle Gesellschaften produzieren eine bestimmte Menge psychischer Gewalt zwischen ihren Mitgliedern, auch in Zeiten nominellen Friedens. Industrielle hochtechnifizierte Gesellschaften produzieren nicht nur Waren und ihre Umschlagplätze, Architekturen, Straßen, Wissenschaften und Technologien, sie haben auch einen hohen Output an Verhaltensweisen, Denkweisen, Gefühlslagen, Lebensformen.
Dass bestimmte Wohnformen unter dem Begriff »Gewalt gegen die Körper der Bewohner« beschrieben werden müssten, haben verschiedene Schriftsteller bemerkt.
Dass bestimmte Formen der Industriearbeit auf eine Zerstörung der Körper der Arbeitenden hinausliefen, ist aus dem Frühkapitalismus, aus Sklavenarbeiten, aus Formen der Kinderarbeit und anderen Ausbeutungsverhältnissen bekannt.
Dass die zivilen Formen des Zusammenlebens Gewalt produzieren können, wissen nicht nur die geschädigten Kinder. Schulen und andere Ausbildungsinstitutionen bearbeiten immer auch Gewalt; die in sie hineingetragene Gewalt und auch die in ihnen selber erzeugte.
Auch in den produzierten Waren steckt ein Anteil verdichteter Gewalt. In jedem Auto z. B. steckt sowohl seine Tötungsgewalt wie auch die Gewalt seines Designs. Von seinen umweltbelastenden Ausstößen zu schweigen. Jede dieser Gewalten wirkt auf die Umwelt, sie strahlt aus. Jedes Stück Ekel-Blech, das sich raumgreifend über die Straßen bewegt, trifft design-empfindliche Menschen in ihrem Innersten. Die Wut darüber können sie aber nicht auslassen durch Tritte gegen das Blech. Sie müssen es ertragen wie auch den Anblick ihres Büromobiliars, den schlechten Schnitt von Treppenhäusern oder Eisenbahnwaggons, die Form von Fernsehern oder den Haar- und Hosenschnitt von Jugendlichen (oder Alten), obwohl all das sie andauernd »nervt« Das Resultat ist eine unerledigte Menge diffuser Gewalt in den Körpern der Menschen: Resultat der gesellschaftlich in sie induzierten Energien und der Körperbearbeitungsformen, die sie erfahren. Außer der sozial genehmigten gelegentlichen »schlechten Laune« haben die meisten dieser aufgestauten Gewaltkomplexe keine eingespielten verlässlichen Abfuhrbahnen. So äußern sie sich in Depressionen, Hass, Wutausbrüchen oder anderen Debalancierungen des psychischen Gleichgewichts. Guter Schlaf und das tägliche Entleeren von Darm und Blase helfen. Aber nicht für Alles.
These: soweit ich sehe, geschieht die gesellschaftlich organisierte Gewaltabfuhr heute überwiegend in verschiedenen Formen des Sports; des aktiven wie des »passiven« Sports; also durch Ausübung wie auch durchs Zuschauen; und zwar bei Männern wie bei Frauen und den Kindern auch.
Sprung nach Karlsruhe.
9. März 2015: Red Bull Leipzig spielt gegen den Karlsruher Sportclub; Zweitligafußball; beide mit Aufstiegsambitionen in die 1. Liga.
Bericht des Journalisten Christoph Ruf:
Gegen 23:30 konnte dann auch Ralf Rangnick den Parkplatz vor der Karlsruher Haupttribüne verlassen, auch der Mannschaftsbus der Gäste rollte zu diesem Zeitpunkt leicht verspätet von dannen, nachdem ein Farbbeutel in Richtung Parkplatz geschleudert worden war.[1]
Vor dem Spiel hatten Karlsruher Fans das Mannschaftshotel der Leipziger aufgesucht, waren aber nicht direkt tätig geworden. Der Vorfall wird von Rangnick, ebenso wie das Blockieren des Mannschaftsbusses, als Teil einer »Drohkulisse« gewertet. Christoph Ruf:
RB ist seit seiner Gründung im Jahr 2009 Zielscheibe einer grundsätzlichen Kommerzialisierungskritik im deutschen Fußball, die in der Ultraszene geteilt wird. Daß der Red-Bull-Konzern mit immensen Finanzmitteln versucht, möglichst schnell ins internationale Geschäft zu kommen, halten die Anhänger der Traditionsvereine mehrheitlich für einen Frevel. Ärmere, aber seriös arbeitende Vereine wie Mainz, Augsburg oder Freiburg drohten mittelfristig in der Zweiten Liga zu verschwinden, wenn konzernfinanzierte Zweitligaclubs wie Ingolstadt oder Leipzig überhand nähmen.
RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick ist offenbar gerade dabei, die Rolle des offiziellen Buhmanns, der mit Industriegeld neue Vereine aus dem Boden stampft, von Hoffenheims Dietmar Hopp zu übernehmen. Die schon länger auf dieser Ebene etablierten Großklubs aus Wolfsburg und Leverkusen haben die »Fans« dabei augenscheinlich nicht im Blick. Selektive Wahrnehmung, wie bei allen Erscheinungen, in denen die jeweils »angesagte Sau« »durchs Dorf gejagt« wird.
Dabei ist all diesen Verfolgern eins gemeinsam: Sie fahren Golf, sie schlucken Aspirin, sie benutzen die Software von SAP – und RED BULL saufen tun sowieso alle; mit und ohne Wodka drin. »Böse« ist im Augenblick aber vor allem »RB«. Im Gegenzug – Notwehr – bringt Rangnick für Fans, die handgreiflich würden, Gefängnis-Strafen ins Spiel; in juristischen Schnellverfahren, »wie bereits praktiziert in Italien«. »Großer Protest« bei den Fanbeauftragten, natürlich. »His Majesty, der Fan«, darf alles.
Grundlage dessen ist die postulierte Wahrnehmung vom Stadion als »rechtsfreiem Raum«. Diese Wahrnehmung wurde und wird unterstützt vom Anspruch der Sportverbände (nicht nur des Fußballverbands) auf ebenfalls eigene Rechtsprechung, nämlich Rechtsprechung von Sportgerichten, die – auch hier: ganz selbstverständlich – von den Verbänden in Anspruch genommen wurde und wird. Der DFB bzw. die DFL stecken in dieser selbstgebauten Zwickmühle. Die Fans (nicht nur die sog. Ultras; und nicht nur die Hooligans) nehmen ja für sich nur in Anspruch, was die Verbände selber auch tun: Sonderrechte; und zwar Sonderrechte auch im juristischen Sinn; etwa wenn sie für sich ganz selbstverständlich das Recht ungehemmter Feuerwerkerei in den Stadien für sich in Anspruch nehmen. Oder auf ihren Transparenten Gegner nicht nur beleidigen sondern körperlich bedrohen.
Warum aber das Zündeln und das Abbrennen von Rauchbomben im Stadion »erlaubt« sein soll, wo es doch außerhalb der Stadien das ganze Jahr über (außer an den Silvestertagen) im öffentlichen Raum überall (ganz selbstverständlich) verboten ist, weiß »der Geier«. Die speziellen Regeln, die für den Umkreis des organisierten Fußballspiels Geltung beanspruchen, sollen dies aber erlauben.
Funktionäre (und auch ein Teil der Sportjournalisten) tun aber so, als würde man bei Verhandlungen über solche Übertretungen große »Zugeständnisse« von den Zündelfans verlangen, wenn sie doch nur tun sollen, was für alle andern auch gilt: sich an geltende Gesetze halten. Große unschuldige Gesichter: »Wieso denn das?« »Wir sind doch nur Fans, die ihrer Freude Ausdruck geben«. »Oder vielleicht auch des Zorns«. »Unser gutes Recht«. Was sonst.
Es erinnert strukturell an den Umgang der Katholischen Kirche mit ihren Priestern. Die Kirche verhielt und verhält sich, als hätte sie das Recht zur eigenen, internen Rechtsprechung bei deren Verfehlungen. Vergleichbar verhalten sich die Fans und teils die Vereine (wenn hier auch keine dem sexuellen Mißbrauch vergleichbaren Straftaten vorliegen).
Der »rechtsfreie Raum« ums Stadion und im Stadion ist keineswegs ein kleines und schon gar kein marginales Problem. Dass eigene Regeln für das Spiel selber gelten, in die das bürgerliche Recht nicht hineinzuregieren hat, ist unbestritten – und gehört zur Substanz der ganzen Veranstaltung. So wie das bürgerliche Gesetzbuch auch für die Regeln des Skatspiels nicht zuständig ist. In der Welt des Spiels gelten die Regeln des Spiels. Bloß, was ist da, wo die beiden Welten sich überlappen. Womit wir beim Hauptproblem wären.
Besonders in Gegenden, wo der Fußball einen großen Teil des öffentlichen Lebens wie auch des Familienlebens ausmacht, wie etwa in der Schalke-Kultur in Gelsenkirchen oder in der BVB-Welt in Dortmund, findet sich ein Großteil der Fans genau deshalb im Stadion am Samstag ein (oder in den Übertragungskneipen), weil sie die Welt der Regeln am Arbeitsplatz für ein paar Stunden oder auch das ganze Wochenende verlassen wollen.
Beispiel aus einer anderen – aber eben doch nicht so anderen – Kultur. Zitat:
Einer der Anführer der militanten Fanklubs des Kairoer Fußballklubs Al Ahly, erklärte das einmal so: „Fußball ist größer als Politik, er ermöglicht die Flucht aus der Realität.“ Er beschrieb den durchschnittlichen Ahly-Fan als einen Mann, „der mit Frau, Schwiegermutter und fünf Kindern in einer Zweizimmerwohnung lebt, einen Minilohn verdient und auch sonst beschissen dran ist. Das einzig Gute in seinem Leben sind die zwei Stunden am Freitag, in denen er im Stadion sein Team anfeuert.
So weit so gut; oder so schlecht.
Eintritt in die wochenendliche Fußballwelt heißt aber oft mehr: Nicht nur Verlassen der Welt der Arbeitsbedingungen und der familialen Welt; sondern Eintritt in ein nicht exakt definiertes Reich der Übertretungen.
In der Westwelt: »Ordentlich einen draufzumachen« ist ja wohl das Mindeste. Wobei Man(n) manchmal weitergehende Programme zu erfüllen hat. etwa die, zwanzig Frauen am Wochenende flach zu legen und zwei Fässer Bier leerzusaufen, wie es ein deutscher Torhüter, tätig im englischen Profifußball, von dort – von dieser barbarischen Insel – als selbstauferlegtes Fußballerwochenendprogramm reportiert. Alles natürlich kein Scheidungsgrund. Fußballerischer Freiraum eben; rechtsfreier Raum. Der Fan in freier Wildbahn eben. (Montags dann wieder brav bei der Arbeit. Wochengespräch: Schalke, oder ManU).
Daß »Fußball« dabei oft nur der Vorwand ist zum Kreiieren eben dieser freien Wildbahn ist ebenso bekannt, wie das öffentliche Vorgeben »religiöser« Zwänge oder Motive beim Begehen illegaler Handlungen bis hin zu Mordtaten durch jene »religiös motivierten Fundamentalisten«, die nach bürgerlichem Gesetzbuch schlicht unter »Straftaten« fielen; und (manchmal) entsprechend verfolgt werden.
Diese Sorte Fankultur hat Einiges zu verlieren, wenn das Zündeln und das körperliche Austoben, alkoholisierte Randalieren einschließlich Prügelorgien ihnen abgestellt würde; ein Rattenschwanz weiterer »abgestellter Privilegien« würde über kurz oder lang folgen. Ein Weltuntergang! Nicht weniger.
Ähnlich gebärden sich die Profivereine selber, wenn Stadtverwaltungen – wie etwa die in Bremen – den Vereinen damit drohen, für die Kosten des Polizeiaufgebots am Fußballwochenende nicht mehr allein aufkommen zu wollen, sondern den Verein, in diesem Falle Werder Bremen, zur Kostenbeteiligung an der Fan-Kontrolle zu bitten. Empörter Widerspruch des Vereins! So selbstverständlich lebt das Management dort in der Inanspruchnahme eines gesonderten Rechtsraums für das Fußballwesen.
Haben die denn noch alle? Die Allgemeinheit soll für das Polizeiaufgebot gegen den Fan-Wahn aufkommen? Also auch die Leute, die den ganzen Zinnober ohnehin ablehnen? Und schon ertragen müssen, wie die fußballverstopften TV-Kanäle von ihren Gebühren mitfinanziert werden? Die Chuzpe, mit der die Fußballwelt auf ihre Sonderrechte pocht, ist schon ganz erstaunlich.
Wie die Sache sich erklärt? Der partiell rechtsfreie Raum um den Fußball und seine Stadien wurde stillschweigend geduldet und sogar gehegt, solange die »Fans« dort nicht weiter auffielen, außer durch die paar allfälligen Schlägereien und Besäufnisfolgen. In diesem Rahmen läuft das Ganze eher als Teil einer allgemeinen »Befriedungsstrategie« von Teilen der arbeitenden und auch arbeitslosen Bevölkerung, die unter anderen Umständen womöglich anders – d. h. politisch relevant – aufmüpfig würden.
Diese Befriedungs-Selbstverständlichkeit scheint momentan dabei, in die Brüche zu gehen.
Als Gründe dafür sehe ich, grob gesagt, die laufenden Kriege der verschiedenen Art: sowohl die sozialen Kriege um Arbeitsplätze, Lohnkämpfe, Einwanderung, Umgang mit den Fremden und dem Fremden; die Kriege um Geldwert, Steuerverhalten, die deutsche Lage im Euro-Wesen. Wie auch die äußeren Kriege: Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Mali, Kongo, Ghana, Zentralafrikanische Republik usw.
So ist Pegida eine ganz direkte Folge des Flüchtlingsaufkommens aus diesen in Kriege getauchten Gebieten; Kriege, von denen Deutschland nicht mehr sagen kann, es führe sie gar nicht. Genau dieser Punkt hat sich verändert in der deutschen Wahrnehmung der letzten beiden Jahre.
Untergegangene Illusionen.
Sprung nach Ägypten:
Vom Persischen Golf bis zur nordafrikanischen Atlantikküste macht der Fußball dem Islam bei der Schaffung eines alternativen öffentlichen Raums seit knapp dreißig Jahren ernsthaft Konkurrenz. Als im Dezember 2010 die arabische Rebellion begann, war der Fußball bereits einer der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Bereiche, der sich den repressiven Regimen und ihren Sicherheitsapparaten ebenso erfolgreich widersetzte wie den militanten Islamisten.[2]
Seit etwa zwanzig Jahren läuft zwischen den Fans und den autokratischen Herrschern ein Katz-und-Maus-Spiel um die Hoheit über die Stadien. Zugleich wehren sich die Fans auch gegen die Versuche der Dschihadisten, die Jugendlichen bei ihrer Fußballbegeisterung zu packen und für ihre Sache zu rekrutieren. Offensichtlich gehen alle konkurrierenden Gruppen – die Fans, die Regime und die Islamisten – von der Prämisse aus, dass nur der Fußball ähnlich intensive Gefühle und eine ähnliche Opferbereitschaft bei der Mehrheit der Bevölkerung erzeugen kann wie die Religion.
Vor diesem Hintergrund war es unvermeidlich, dass die staatliche Reaktion auf die Protestbewegung zuallererst den Profifußball traf. Wann immer im Nahen Osten oder im Maghreb die Massen gegen die Regierung auf die Straßen gingen, verfügte die politische Führung fast automatisch die Aussetzung des Ligabetriebs, weil sie in jedem Fußballstadion eine potenzielle Arena für oppositionelle Kundgebungen sieht.
In Syrien hat das Assad-Regime schon Anfang 2011, noch bevor es gewaltsam gegen die Bevölkerung vorging, den Fußballbetrieb auf unbestimmte Zeit suspendiert. Dadurch wurden die oppositionellen Kräfte in die Moscheen zurückgetrieben: Wenn die Stadien kein öffentlicher Raum mehr sind – auch weil sie den Sicherheitskräften als Sammelstellen und Internierungszentren dienen – verlagern sich die meisten Proteste in die Moscheen, weil sich dann nur hier größere Menschenmengen versammeln können.
In Tunesien, Ägypten und Algerien hatte die Aussetzung des Fußballbetriebs zur Folge, dass die oft militanten, hoch politisierten und gewaltbereiten Fußballfans statt im Stadion auf den öffentlichen Plätzen protestierten. Dort fiel ihnen häufig eine besondere Rolle zu: Sie halfen den Demonstranten, die von den neopatriarchalischen Autokraten errichtete Angstbarriere zu überwinden, die ein wichtiger Grund war, warum die Massen deren Herrschaft bis dahin schweigend und passiv hingenommen hatten.
Deshalb entfalteten Fans in Ägypten bei einem der ersten Spiele nach dem Sturz von Mubarak ein Banner, auf dem sie ihre Idole kritisierten: „Wir sind euch überall hin gefolgt, aber in den harten Zeiten konnten wir euch nicht finden!“
Angefügt noch diese Info:
Im fußballverrückten Ägypten befindet sich die Hälfte der 16 Erstligaklubs im Besitz des Militärs, der Polizei, einzelner Ministerien oder Provinzregierungen. Und die 22 Fußballstadien des Landes wurden von Baufirmen errichtet, die dem Militär gehören.
Das interessanteste an dieser Beschreibung ist das Datum: Januar 2012. Hier, vor gut zwei Jahren, hielt es der Autor noch für möglich, dass in der Konkurrenz zwischen Sicherheitsapparaten des Staates, dem militanten Islamismus und der fußballverliebten Zivilgesellschaft »der Fußball« die Oberhand behalten könnte. Das könnte heute – leider – niemand mehr sagen. Die Kraft der Fußballszene wurde über-, die des Staates unterschätzt; und die der Islamisten sowieso.
Kriegerisches, neu
Zurück nach Deutschland: Gerade die demonstrative Installierung einer Frau auf dem Posten des sog. Verteidigungsministers hat unterstrichen, dass hier jetzt ein anderer Ernst herrscht. Der blonde Engel mit der durch nichts zu erschütternden blonden Betonfrisur[3] ist ausersehen, »den Deutschen« klar zu machen, dass sie sich »im Krieg« befinden, und zwar in mehr als einem. Bemerkenswert die fast einhellige Zustimmung zur Erhöhung des Militärhaushalts im Bundestag. Dieser netten Frau kann man ja nichts abschlagen.
Das ganze Gerede von der »gewachsenen deutschen Verantwortung« für die Belange der Welt – bloß weil die Wirtschaft hier ganz gut läuft oder zu laufen scheint; – dies Gerede, das die Herren Schröder und Fischer in die Welt gesetzt haben, um ihren Einfluß auf den Zugang zu bestimmten Bodenschätzen in der Welt dem deutschen Militär- und Regierungseinfluß zu erhalten, ist unter der Regierung Merkel, mehr oder weniger zwangsläufig, übergegangen in die betonierte Feststellung eines Ist-Zustands. Es ist Krieg in der Ukraine; es ist Krieg in Teilen Afrikas und Asiens; und Deutschland – so sehr seine »Führung« dies zu verbergen sucht – hat die Finger im Spiel.
Es ist umso mehr Krieg in der Ukraine, als in der Berichterstattung über das grandiose 7:0 der Bayern aus München über Schachtjor Donezk in der Champions League der Herr Putin und seine Truppen ausnahmsweise nicht erwähnt wurden.
Es ist Krieg; aber wir sollen glauben, es wird noch gespielt.
Für die USA, seit dem Sieg im 2. Weltkrieg beherrscht von den Militärs (und nicht von seinen Präsidenten und deren Partei) ist der »Kalte Krieg« nie beendet worden. Noch schärfer gesagt: es hat ihn nie gegeben. Für die USA haben die heißen, d.h. der 2. Weltkrieg und dann auch der Koreakrieg, nie aufgehört. Der sog. »kalte« war ihnen immer nur die Fortsetzung des heißen mit gerade anderen Mitteln. Und wo immer es ihnen nötig erschien, haben sie den »heißen« aufflammen lassen; oder aber under cover, mit geheimdienstmäßiger Gewalt, die gewünschten Ziele erreicht (manchmal auch nicht erreicht).
Deutschlands Rolle in diesem Spiel? Nicht nur, dass die deutsche Beteiligung an der Bombardierung Belgrads so etwas wie das Feigenblatt für den nicht von der UNO gedeckten Angriff der USA auf Serbien abgab (ein durch den Außenminister J. Fischer – einen fanatischen Freizeitfußballer – höchst bereitwillig und frech aufgezogenes Feigenblatt); auch die Rolle Deutschlands als nun mit einem Mal »mächtigstes Land« innerhalb der EU bei der Ausdehnung der NATO auf Polen und die weiteren Länder an den Grenzen Russlands, kann nicht mehr übersehen werden. Oder glaubt irgendein aufmerksamer (oder auch nur irgendein dumpfer) Deutscher, dass dies ohne zustimmende Beteiligung Deutschlands so hätte vonstatten gehen können?
Aus Spiel ist, wie unter der Hand, Kriegsspiel geworden.
Seine lobende Rezension des Films »Futebol e vida« – Daniel Cohn-Bendits Fußballfilm von der WM in Brasilien 2014; an der Kamera sein Sohn, der Filmemacher Niko Apel – beschließt der Politikwissenschaftler Claus Leggewie mit den Worten: »Der Film bereitet schon vor auf die Pein von 2018 und 2022: Werden die Anhänger des „jogo bonito“ den unumgänglichen Boykott der WM in Russland und Katar mittragen«? (taz, 10. März 2015)
Das ist eine schlaue Frage, etwas verklausuliert. Sie hält den Boykott der WM’s 2018 in Russland und 2022 in Katar für unumgänglich – wegen der kriegerischen Politlagen nämlich – und fragt, ob sich Brasilien, etwas weiter weg vom Schuß, sich dem (unumgänglichen!) Boykott der europäischen Verbände anschließen wird.
Fußball – gerade die Fußballwelt in ihrer Eigenschaft als größtes gesellschaftliches Parallelfeld zum Ausagieren von Konflikten, die aus der gesellschaftlich-politischen Welt stammen – ist davon nicht unberührt; kann, so Leggewie, davon nicht unberührt sein.
Es ist nicht mehr die Ebene des früher so gern gezogenen Vergleichs zwischen der Figur des Kanzlers/der Kanzlerin und dem Bundestrainer, auf der die Spuren einer solchen Parallelisierung zu verfolgen wären. Auf dieser Ebene verhält sich alles sehr kontrolliert und scheinbar unberührt voneinander.
Es ist vielmehr das Umfeld des ganzen »Fußballstaats«, das solche Parallelen sichtbar werden lässt. Ganz direkt: ein Teil der Fankultur führt Krieg. Ob es das Gefolge des Dresdner Fußballs ist, das dauerrandalierend durch auswärtige Stadien zieht oder Teile der Dortmunder Fanszene, die ihre Neo-Nazi-Nähe ausstellen: sie sind nicht allein auf weiter Flur. In den meisten Fußballstädten gibt es derartige, wenn auch meist sehr kleine Gruppen in der Fanszene; sie sind – mit ihrem klaren Gespür für Räume, in denen Machtvakuen vorliegen, dort hineingeströmt und nehmen nun den postuliert »rechtsfreien Raum« der Stadienwelt für sich in Anspruch. Und die Vereine – selber um den partiellen Erhalt ihrer »Rechtsfreiheit« kämpfend – unternehmen zu wenig oder nichts dagegen.
Nicht nur im Stadion-Umkreis: wo »Salafisten« und »Hooligans« gegeneinander aufmarschieren – zwei Formationen, die ganz klar Eigengesetzlichkeit für sich reklamieren – findet sich der »rechtsfreie Raum Fußball« in den Raum »rechtsfreie Öffentlichkeit insgesamt« übertragen. Pegida und ihre Gegendemonstranten sind ziemlich deutlich ein Ableger dieses Verhältnisses.
Pegida führt klar Krieg. Krieg gegen Einwanderer, Flüchtlinge und Asylsuchende, die genauso wenig einen Fuß nach Deutschland setzen sollen wie ein feindlicher Fan-Fuß sich finden soll im Bereich, in dem die BVB-Neo-Hooligans »regieren«. »Hier regiert der BVB« war einmal ein Spruch innerhalb des Stadions, bezogen auf die Vorgänge auf dem Rasen. Der »Regierungsanspruch« hat sich nach außen verlagert und definiert sich nicht mehr nur fußballerisch, sondern allgemein politisch.
Alle Fangruppen reagieren mehr oder weniger deutlich auf diese Verschiebung der Machtverhältnisse im Umkreis der Stadien. Wenn Fans des FC St. Pauli beim letzten Spiel im eigenen Stadion Transparente zeigen, die es wichtiger finden, dass Flüchtlinge in Hamburg anständig untergebracht und behandelt werden als dass ihr Verein das Spiel gewinnt – obwohl dieser sich in akuter Abstiegsgefahr befindet – ist ein deutlich davon abweichendes Verhalten; deutlich bezogen auf gegenteilige politische Verfahren anderswo und setzt ganz andere Prioritäten.
Internet-Spiele.
Treten wir kurz ein in eine andere – aber doch nicht ganz andere – Spielwelt. Ins Internet! Auf die Eingabe »Spielen« bei google erscheint nichts zum Verb »Spielen«. Die Suchmaschine übersetzt gleich substantivisch in »Spiele«.
Ganz oben erscheint: »Jetzt spielen.de«: ich klicke. Es erscheint die Angabe: 3000 kostenlose Spiele. »Jeden Tag neue online-Spiele«. »Für dich«. (Man wird geduzt auf »Jetzt Spielen.de«).
3000 Spiele mit je einem Bild, angeordnet in Sechserreihen. Erstes Spiel: »Papa Louie 3: Eisbecher greifen an« (nicht: Eisbrecher!) Zwei: »Cooking Academy: Burger«. Drei: »Einkaufstraße (Shopping Street)«. An vier: »Kings of Fighters«, ein Ego-Shooter.
Ich klicke die eins an; eine Spielanleitung erscheint. Aber ehe ich darauf richtig reagiere, schaltet sich eine Werbung ein: Gothaer Versicherungen, gefolgt von einer Riesenpizza. Pizza to Go. Bei der Cooking Academy erscheint eine Werbung für Kaffeemaschinen, dann Media Markt Telefone. Dies stellt sich als Prinzip heraus. Vor jedem neu geöffneten Spiel erscheint der Satz: »Nach der folgenden Nachricht von unserem Sponsor kannst du dieses Spiel weiter spielen«. Dann Einladung zu Lavazza Kaffee oder »Nivea, eine Creme ohne Aluminium«. Plötzlich dann eine Werbung des Internet-Versands Redcoon. Angeboten werden Geschirrspüler. Moment! Ich habe vor ein paar Tagen über google bei redcoon nach Geschirrspülern gesucht. Der Computer hat sich das offenbar gemerkt – nein, Quatsch, die Suchmaschine hat es registriert und gespeichert. Und sie schickt mich nun, mitten aus der Seite »Jetzt Spielen.de, Shopping Street« mit einem Pfeil zurück auf die redcoon-Seite mit dem von mir vor einigen Tagen betrachteten Bosch-Geschirrspüler. Merkwürdiges Spiel.
»Kings of Fighters« bietet als Personal 9 martialisch fernöstlich aussehende Kämpferfiguren im Comic Look; sieben männlich, zwei weiblich. Dann ein Button zur Auswahl des Schwierigkeitsgrads: »Select Difficulty: Normal oder Hard.
Ein Typ mit nackten Oberarmen, rotes Piratenkopftuch, martialische Fresse, eine Art Raketenwerfer im Anschlag, gebleckte Zähne.
»One Mouse Click to “Auto Shoot”. Then click again to stop shoot; kill all enemies to proceed«, ist die Anweisung. »Alle Feinde töten, um weiterzukommen«. Dann knattert es los. Man soll sich beteiligen und wieder wo klicken oder drücken. Ich tue nichts und erhalte die Nachricht: »Verloren!« »You lose! Rambo is dead!« Spiel fertig. Wer nicht selber schießt, wird erschossen, Loser!
Unten drunter eine Sechserreihe mit »Ähnliche Spiele« und eine Werbung für den Biene Maja-Kinofilm. Namen der nächsten Spiele: Trollface Defense – My Dolphin Show 6 – Carstyling mit Harry – Tapferer Ritter – Alter Planet – Popping Pets – Shark Lifting – Hexenjagd – Klo Held – Shooting Action Massacre – Filmwerbung: Warner Bros: Gespensterjagd.
3000! Wir säßen morgen früh noch hier bloß beim Titel nennen. Das Programm solcher Häufung ist offenbar: Vollzeitbeschäftigung für Arbeitslose. Und das ist noch gar nichts. Anklicken des Links »SPIELAFFE« bietet 12.000 Games zum Ausprobieren.
Und 12.000 Werbespots.
Ich stelle mir seit Jahren die Frage, was unsere Regierungen, Behörden, Schulen, Vereine etc. eigentlich unternehmen, um dieses ungeheure menschliche Potential, das durch die Umwälzungen in der Arbeitswelt nicht mehr zu festen Anstellungen gelangt und zu großen Teilen arbeitslos wird, nicht ungenutzt verkümmern zu lassen. Man müsste doch ganz neue Wege finden, all diese Menschen in vernünftige und erträgliche Beschäftigungen einzubinden, die ihnen die Chance geben, sich weiter zu entwickeln, menschlich wie intellektuell.
In dieses Vakuum – es ist ein weiteres Vakuum, das die für das öffentliche Leben in Europa Zuständigen geschaffen und dann so belassen haben – in dieses Vakuum ist voll die elektronische Spiele-Industrie auf den Flügeln des Internet seit Mitte der 90er Jahre eingeströmt.
Der Historiker Ulrich Herbert stellt am Ende seiner »Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert« die Frage: »Wann war das 20. Jahrhundert zu Ende«? Von seinen Studenten bekam er eine ganz unerwartete Antwort. »1995« sagten sie. »Das Jahr steht für die weltweite Durchsetzung des Internets, das damals in Westeuropa etabliert wurde, und damit für den Beginn des digitalen und das Ende des analogen Zeitalters«. (S. 1238) Zeitalter, das Cheffrau Angela Merkel noch im letzten Jahr als »Neuland« für sie (und die meisten von uns) bezeichnete. Eine Digitalwelt, die die letzten 20 Jahre genutzt hat, dort, neben vielem anderen, auch 12.000 Spiele zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, die, u.a., dafür Sorge tragen, dass kein computerbesitzender Arbeitsloser in seinem womöglich doch langen Leben je beschäftigungslos sein wird. In den Spielpausen – man kann ja nicht immer ganz dasselbe machen – locken dann die Fußballübertragungen, locken Champions League, Europa League, die Bundesliga sowie Welt- und Europameisterschaften mit weiterem Digitalfutter, gewirkt aus dem runden Leder, das kein Leder mehr ist. Die dritten Programme übertragen auch lokalen Drittligafußball. Auch in Kiel und Bielefeld ist man Teil der großen Digital-Spiele-Welt. So müssen nur die, denen das Alles gar nichts sagt, Dschihadisten werden; d.h. Spielverderber mit der Waffe in der Hand. So kann man auch siegen (oder siegend untergehen). Und im Jenseits den Neustart-Knopf drücken. Insofern sind auch diese (verkappte) Digitalwelt-Bewohner, Elektronik-Spieler.
Fußball GmbH’s
Die Fußballvereine sind – das ist Ihnen allen bekannt – seit einer Weile Wirtschaftsunternehmen mit z. T. beträchtlichen Budgets und Etats. Lokal gibt es darin große Verschiedenheiten. Z. B. half bei der wundersamen Wiedererstarkung des Vereins Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren
natürlich, dass sich auch weit über die Stadt am Niederrhein hinaus viele Menschen mit diesem Klub identifizieren. Im neuen Stadion stieg die Zuschauerzahl um 60% auf 52.000. Die Sponsoring- und Fanartikel-Erlöse wurden verdreifacht. Der Gesamtumsatz hat sich seit 1999 auf 122 Millionen Euro fast versiebenfacht. Die Fußball-GmbH, eine 100-prozentige Tochter des Vereins, verfügt über das Stadion ebenso autark wie über Namens-, Vermarktungs-, Catering- und sonstige Rechte. Ende 2017 soll neben dem Stadion ein Neubau mit Hotel, Museum, Fanshop und Reha-Zentrum eröffnet werden. „Wir sind Herr im eigenen Haus“, sagt Schippers. Unabhängigkeit steht als eines von mehreren Leitwörtern in der kleinen „Mitspielerfibel“, die jeder neue Angestellte bekommt.[4]
– also etwa so wie früher der Konfirmand den Katechismus mit den zehn Geboten bekam; oder der FDJ’ler sein Heftchen mit den Jugendregularien: eine Angestelltenfibel nun mit den Regeln für die Regionalkirche Borussia Mönchengladbach.
Eine weltliche Kirche, selbstverständlich; wie alle vergleichbaren unternehmerischen Projekte in Deutschland rein weltliche Kirchen sind. Sie wollen keine Fundamentalisten; auch keine rein fußballerischen. Ein Fanclub, der nichts gelten ließe außer Günter Netzer, Rupp und Laumen aus der ursprünglichen »Fohlenelf« wäre nicht im Sinne des Vereins; nicht im Sinne der Fußball-GmbH MG. Neubau, Neubauten, und zwar keine einstürzenden. Namens-, Vermarktungs-, Catering- und sonstige Rechte. All diese Einnahmen, dazu die TV-Gelder, erbringen mehr Geld als die verkauften Tickets für die Spiele. Fans, die ihre Kriege führen im und um den »rechtsfreien Raum« Fußballstadien, will ein solcher Club absolut nicht. Sie schaden. Aber die Kriege sind da; und nur wenigen Clubs wird es gelingen, sie aus den eigenen Bereichen fernzuhalten.
RB Leipzig und Dynamo Dresden gehören wohl nicht dazu.
Es ist allerdings eine Tatsache, dass der DFB und der Fußball eine Vorreiterrolle spielen in der Förderung und beim Einbau junger Spieler nicht-deutscher Eltern in die deutschen Vereine und ins »deutsche Leben«. »Jungprofi« heute heißt, man hat eine der Fußballschulen durchlaufen, die der DFB seit 1998 für alle Profivereine verpflichtend gemacht hat. Die Spieler Neuer, Özil, Khedira, Boateng, Hummels, Marin, Aogo standen in der U21, die bei der EM in Schweden 2005 durch ein 4:0 über England Europameister wurde. Das bedeutet: die etwa 20-Jährigen, die Nationalmannschaftsreif werden, spielen schon seit der U15, also seit etwa sechs Jahren in deutschen Jugendnationalteams. Geboren in Deutschland sind sie außerdem alle. Sie haben kein Problem damit, sich selbstverständlich für das deutsche A-Nationalteam zu entscheiden, wie etwa noch vor ein paar Jahren die etwas älteren Altintop-Brüder, die sich für das Land ihrer Eltern, für die Türkei, entschieden haben. Die Qualität des jetzigen A-National-Teams hat weniger mit Migration als mit einer hochklassigen Fußballausbildung von Kindesbeinen an zu tun; eine Entwicklung, in der Frankreich und Spanien den Deutschen vorausgingen; aber jetzt ist deren Vorsprung aufgeholt.
Die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung hinkt dem weit hinterher. Zeichen dafür sind Blogs aus der rechten Szene vor der WM Brasilien 2014, die dem Team von Löw als »undeutschem« Team Niederlagen wünschten. Hier wird gar nicht mehr in der Kategorie »Spiel« gedacht, sondern gleich in der Kategorie »Krieg«: und Löw/Deutschland (=falsches Deutschland) sollen ihn verlieren. Der dann gewonnene WM-Titel war eine Niederlage für diese Typen: Sieg des Migrantismus
Gewaltabfuhr
Das zentrale Mittel zur Abfuhr angestauter Gewalterfahrungen ist traditionell die motorische Abfuhr gewesen: jede Sorte Bewegung; besonders bei Männern. Heute joggen gleichviele Frauen wie Männer oder treten regelmäßig in die Pedalen.
Aber auch das Zuschauen ist eine spezifische Form von Aktivität, physischer wie psychischer Art. Was früher für das Theater unter der Formel »Katharsis« gefasst wurde, geschieht heute emotional vergleichbar vor dem Monitor mit der Fernsehserie oder der Fußballübertragung; mit dem Unterschied, daß der Zuschauer beim Sport in stärkerer Weise Akteur ist als er es war im Theater. Viele der Bewegungsabläufe der Akteure auf dem Schirm oder im Stadion kennt er am eigenen Leib: nämlich wenn er selber spielt, selber gegen Bälle tritt oder trat.
Fußballspieler und Zuschauer bilden so etwas wie eine Reaktionsgemeinschaft zur Erregung und zur Abfuhr bestimmter Affektkonglomerate. Das Spiel – mit all seinem Brimborium drumherum – hat somit eine eminente sozialpsychologische Funktion.
Mit dem weitgehenden Verschwinden der soldatisch dominierten Gesellschaft nach dem 2. Weltkrieg hat sich dabei ein zunehmender Respekt vor der körperlichen Unantastbarkeit auch der »niederen« Menschen einer kulturellen Hierarchie durchgesetzt. Auch Gewaltabfuhrformen wie die schnelle Rangelei oder Prügelei inmitten einer Schulhofs- oder Kumpelgruppe – wie sie noch zu meiner Schulzeit alltäglich waren – haben ihre hohe Relevanz im Sozialverhalten eingebüßt. Der noch in den 60er Jahren verbreitete Ein- und Übergriff in die in Reichweite befindlichen Körper der Mitmenschen, wurde zunehmend zurückgebaut und ist heute selbst unter pubertierenden Jugendlichen nicht mehr die Regel; und unter zivilisierten Erwachsenen streng geächtet.
In der Normalität hochtechnologisierter, institutionell ausdifferenzierter Gesellschaften sind somit fast alle alten Formen der Gewaltabfuhr bzw. Gewaltweitergabe aus dem Verhaltensrepertoire verschwunden.
Zu einem hohen Grade sind sie ersetzt worden durch Spiele; durch eine Vielfalt von Spielformen.
Durch die hochtechnologisierte Industrie- wie auch Agrarproduktion hat sich aber auch die direkte Zufuhr von Gewalt in die einzelnen Körper verringert; sie ist heute verdeckter, indirekter. Das heißt nicht, dass sie verschwunden wäre. Sie hat sich verwandelt. Aber sie wird gespürt. Die Ursachen neuer Ängste liegen heute eher in der Unüberschaubarkeit vieler ökonomischer, verwaltungstechnischer und technologischer gesellschaftlicher Vorgänge; in der Arbeitsplatzunsicherheit; in neu entstandenen Verhaltensformen; ein Wort wie »Mobbing« z. B. gab es nicht im alten Abfuhrsystem.
Die Behauptung, »Fußball ist Krieg«, die dem holländischen Trainer Rinus Michels zugeschrieben wird, machte lange Zeit absolut Sinn: der Fußball als (im Kern) reiner Männersport, Männerkampfsport, Körperertüchtigung (verdeckt) soldatischer Männer; ein Militärableger mit dem Ziel der untergründig fortdauernden Kampf- und Vernichtungshaltung der Gesellschaft.
In den Fußballinternaten heutiger Profivereine liegt das Schwergewicht aber auf ganz anderen Dingen; nämlich auf der Entwicklung der »artistischeren« Seiten des Spiels. Sie legen es nahe, Fußball gerade nicht als »Krieg« zu sehen.
Der selbstverständlichste Unterschied zwischen Spiel und Krieg: der überwachte Kanon des Fair Play, der Respekt der Spieler voreinander, die Anwesenheit von Schiedsrichtern, ‑ während der Terror des Kriegs prinzipiell schiedsrichterlos läuft.) Was tut Fußball? Sicherlich organisiert er einen Kampf; Kämpfe um die Herrschaft über ein bestimmtes Stückchen Erde – also genau das, worum Staaten Kriege führen. Er gibt dazu allerdings beiden Parteien ein-und-dasselbe Spielgerät in die Arena, den Ball. Dieses Spielgerät darf nicht zerstört werden. Dies ist der entscheidende Punkt bei der unkriegerischen Lösung des angepfiffenen Spiels. Beide Mannschaften »kämpfen« auch für die Unversehrtheit des Balles. Am Grunde des Spiels liegt für alle ihre Liebe zum Ball. Für das »All im Ball«.
Zwei Typen im Trikot, die hinter demselben Ball herjagen, die sich jeden Zentimenter und jede Zehntelsekunde erkämpfen müssen, in denen sie mit dem Ball »ihr Ding« anstellen können, das sind »You and Me« bei der Suche nach der Lücke. Nach der Lücke für die Freiheit. »Frei zum Schuss kommen« ‑ beinah unermeßlich, was das heißt.
Deswegen ist der Aufschrei der Massen so einmütig und groß, wenn der Frei-zum-Schuß-Gekommene nicht verwandelt: Oh Gott, was für eine Vergeudung! Leben wir so im Überfluß, daß man so ein Ding vergeigen kann? Leben wir nicht!! Wir denken ökonomisch. Jedes dieser Dinger muß rein, 3:1, 4:1, egal. Der vieltausendstimmige Schrei ist immer auch eine heftige Gewaltentladung. Und eine je gelingendere, je mehr solche Dinger »drin« sind.
Das Wort »verwandeln« trifft es genau. Ein Ball, der ins Tor geht, ist ja nicht »verwandelt«; Thomas Müller tut ihn bloß rein; der Ball ist (fast) der gleiche wie vorher. Aber die Zuschauer sind verwandelt, die ganze Situation ist verwandelt. Der Treffer verwandelt 25.000 oder 50.000 Verzagte in 50.000 Schreiende, Hüpfende, ihr Herz in die Luft Werfende. Wo sonst gibt es soviel Verwandlung im Zivilalltag?
Der Charakter solcher Entladung ist ein serieller. Fußball garantiert Fortsetzung: Neuer Anfang, Revanche und wieder Revanche. Ein fliegender Teppich, auf dem im Rhythmus der Jahreszeiten »das Leben« spielt. Man kann dabei zusehn, wie das Aggressionspotential der Jubilierenden sich ins Nichts verduftet. Das Stadion schwebt. Nur lachende Gesichter, Umarmungen. Schlusspfiff, kollektiver Aufschrei, Zustimmungsschrei – und die Masse verströmt sich in den strahlenden Samstag. Das ist der gute – und tatsächlich auch immer wieder passierende – Ablauf des Wochenendspektakels.
Entladung „.Der Schrei“. Wo im alltäglichen Leben kann man seinen Mund aufreißen und einen Schrei herauslassen, der so laut ist, wie man ihn nur schreien kann und so ungehemmt, wie immer man das möchte. Sei es als Torschrei, da sowieso, oder auch als Wutschrei: »Neeeiiin, das doch nicht! Du Double!«. Ein Schrei, den Fünfzigtausend oder Zwanzigtausend im selben Moment so schreien, weil sie dasselbe gesehen haben und dasselbe empfinden; Schrei, eingebettet in die kollektive Entladungssituation. Er führt wirklich etwas ab. Die Menschen entledigen sich ihrer »Befehlsstacheln« (Canetti). Was in sie hinein gegangen ist an Vorschrift und Unterdrückung wird im emotionalen Aufwallen des gemeinsamen Agierens aus den Körpern herausgeschleudert. Fußballstadien organisieren eine Regelhaftigkeit solcher Abfuhr; sind also immer auch Orte einer ritualisierten Gewaltregulierung.
Wo sonst gäbe es »den Schrei«: »Du Arsch, du blöder!«, ohne dass es eine unerlaubte oder unangemessene Übertretung wäre, ohne dass man jemanden direkt verletzte. Der Schreiende entläd sich, aber der Spieler bleibt unversehrt. Sensationierend besonders für Leute, die sonst nie herumschreien. Man schreit, man weiß, es wird nicht vergolten; Den beschimpften Spieler mag es schwer treffen. Aber er wird bezahlt; man selbst hat bezahlt. Und er hat die Chance, es das nächste Mal besser zu machen. Man merkt, mit all denen, die auch geschrien haben, dass der Schrei tatsächlich erleichtert. Es geht mehr mit hinaus, als nur die Enttäuschung der gerade vermasselten Situation.
Und ist – als erlaubte Übertretung – mit Ende des Spiels wieder gelöscht. Das Stadion organisiert eine gemeinschaftliche Entladung ohne ein reales Opfer; den Spieler trifft es sozusagen symbolisch. Selbst das »du Arschloch«, das man dem Schiedsrichter zubrüllt, ist nach dem Spiel ausgelöscht, vergessen. Keinesfalls würde man es dem Herrn an den Kopf schleudern, träfe man ihn beim Abendessen in einem Restaurant oder in einem Eisenbahnabteil. Keinesfalls? Das war vielleicht einmal so. Es ist nicht mehr so. Der Herr in Schwarz, der das Spiel »verpfiffen« hat, müsste um sein Leben fürchten, träfe er auf Fans der Benachteiligten etwa im Zug nach Hause oder an der Autobahnraststätte.
Fußballspezis, die seit Jahrzehnten die Stadien besuchen, professionell oder in Fangestalt, versichern mir, das war in den 80er, 90er Jahren nicht anders; vielleicht sogar schlimmer. Nur im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts gab es eine – vorübergehende – und sogar rätselhafte Abkühlung der Fangewalt, die nun wieder vorbei ist..
Ich will ihnen glauben – näher am Ball als ich waren sie meistens. Ich dafür näher an einem anderen Ball. Ich nehme den »Kriegsgedanken« noch einmal auf. Der klar beobachtbare Zug, daß bestimmte extremistische Fangruppen – so klein sie auch sind – sich nicht damit begnügen, die »Farben ihres Vereins« oder die »Farben ihrer Region« mit Kloppergewalt den »andern« einzuprügeln, sondern dazu übergegangen sind, weiterreichende politische Etiketten ihren Taten anzukleben, Neonazismus und spezifisch rassistische oder religiös bzw. antireligiös definierte Etiketten. Unter zunehmend Kriegsbedingungen wird Fußball wieder Krieg. Und gerade die gewaltbereiten Fans haben den rechten Riecher dafür. Sie spüren – mit Sicherheit genauer als der normalverdängende Normalfan – daß »unser Land« sich im Krieg befindet. Kriege führt. Das ist eine Art Freifahrtsbillett, das sie für sich selber gern lösen.
Ein Teil der organisierten Meute will »dem Mann, der falsch pfeift« ans Leder, nach dem Spiel; und auch allen anderen »Falschen«. Das Gewaltentladungsritual im Stadion funktioniert für einen Teil der »Fans« nicht mehr. Sie wollen »Blut sehn im Realen«.
Außer Kraft gesetzt werden Zivilisierungsformeln wie: »Die andern können auch Fußball spielen«…»Es kann nicht zwei Sieger geben«…»Es geht nicht immer gerecht zu auf der Welt, aber manchmal gleicht sich das aus«. »Krieg« demgegenüber heißt, solange auf den Feind einzuschlagen oder einzuwirken, bis er sich nicht mehr rührt.
Wer einen bestimmten Pegel körperlicher Gewalt in der Gesellschaft, der seinen Ausdruck und seine Betätigungsfelder sucht, als gegeben annimmt, konnte Fußball als eins der bedeutendsten Mittel benennen, an der Umwandlung dieser Gewaltpotentiale mitzuwirken. Und zwar genau eben dadurch, »immer hart an der Grenze« zu sein und nicht etwas drüber; immer hart an der Grenze zum taktischen Foul, zum grad noch Erlaubten. Die »Grenze« verläuft mitten durch den Zuschauer. Exakter gesagt: 95% der Zuschauer in den Stadien bekämpfen Wochenende für Wochenende erfolgreich den eigenen Hooliganismus. Als Möglichkeit liegt er in ihnen wie in den manifesten Hooligans auch. Sie schaffen es aber, diese Potenz wieder abzuschalten, wenn sie das Stadion verlassen und mit der Straßenbahn entschwinden.
Die Entwicklung des Spiels in friedliche Richtungen wäre nahezu unbegrenzt; wenn die Beteiligten es wollen. Die erste grundsätzliche Verschiebung, die selbst jeder Kampfsport an der Form »Krieg« vornimmt, ist die Verwandlung von Feinden in Gegner. Die oberste Regel des Spiels sagt, daß die körperliche Unversehrtheit des andern genau so zu schätzen und zu bewahren ist, wie die eigene. Das geschieht im Spiel durch die permanente Umwandlung von Vernichtungspotentialen in spielerische Techniken. Jedes Stückchen Technikzuwachs ist ein Stück Gewaltabbau. Ziel jedes vernünftigen Trainings ist die Erhöhung der technischen Potentiale der Spieler – gepaart mit den notwendigen Kraft- und Ausdauerpotentialen.
Eine Zivilisierungsarbeit durch Erhöhung der technischen Raffinesse leisten andere Spiele zwar auch, und vielleicht sogar besser. Bloß: alle spielen Fußball. Schach, Schwimmen, Rudern, Tennis betreiben nur ein paar. Entsprechend größer das friedenstiftende Potential des Fußballs. Er stellt die größte Vereinigungskugel. Der Tennisball die individuellere. Auch gut. Auch zwanzig gelungene Volley Stops erleichtern den Körper von einer Reihe lastender Beschwerden. Es schreien aber keine 50.000 unisono. Und den Millionenschrei am Fernseher kann man sich höchstens vorstellen; er ist kein vergleichbarer physischer Akt wie der »stadium roar«. Wie eine Meeresbrandung, bemerkte Nick Hornby. Deren Läuterungspotential ist auch ganz ordentlich.
Auf Vereinsseite ist es der größte Beitrag des Fußballs zur allgemeinen Zivilisierung der Umgangsformen in den letzten fünfzehn Jahren, dass die Sensenspieler zunehmend keine Verwendung mehr finden und also nicht nachgezüchtet werden. Die technischen Spitzenspieler müssen durch ebenso technische Deckungsspieler ausgeschaltet werden, nicht durch Kloppen auf die Knochen.
Unschätzbar groß dabei ist die Rolle des Fernsehens. Ohne die Wiederholung von Spielzügen im TV, ohne Zeitlupeneinspielungen, angehaltenes Bild in Großaufnahme, ohne Ballberührungsstatistiken, Zählung gewonnener Zweikämpfe, Aufbereitung strittiger Abseitspositionen und vieles Weitere auf dieser Schiene, wäre der Kompetenzblick des Publikums niemals so weit entwickelt worden, wie er es heute ist. Wobei das Fernsehen in großem Maß Frauen als Zuschauer erschlossen hat; mehr als es die »Tatsache Frauenfußball« allein gekonnt hätte. Die Analyse von wiederholten TV-Aufzeichnungen hat das Wahrnehmungsniveau der Zuschauer überall deutlich angehoben
Der schönste Abfuhr- und Verwandlungsvorgang im Stadion ist aber noch nicht benannt: die Entladung durch Erhebung, durch Schönheit. Ein von beiden Mannschaften auf hohem Niveau geführtes Spiel steckt die Zuschauer an und verwandelt sie – Gewinner wie Verlierer – von konkurrenten Einzelwesen in enthusiastische Anhänger von Schönheit. Nicht »work in progress«, sondern »beauty in progress«. Jeder im Stadion lechzt nach schönen Spielzügen, und seien es die des Gegners. In der Überführung von Geacker in ein ästhetisches Erlebnis verwandelt sich das Stadion in genau den Kultort, der die religiösen Kathedralen für die meisten Zuschauer nicht sind.[5] Man möchte nicht gern ohne dieses Erlebnis nach Hause; der kostbare Samstagnachmittag wäre ein halb vergeudeter und man selbst nur ein halb fertiggestelltes Kunstwerk; achtlos weggeworfen vom Künstler als irgendwie mißlungen. Gelingt das Werk aber, dann entsteht diese seltene Zusammenarbeit von Spielern und Publikum, die beide gleich stark erleben: die Gewißheit, die Welt um ein Stück Schönheit erweitert zu haben; eine Schönheit von allerdings sehr flüchtiger Dauer, wie Live Music. Geduldig wartet sie auf den Moment ihres nächsten Eintritts; dies aber in Permanenz.
Akzentverschiebung
In den Sechzigern, Siebzigern und auch noch zum Teil in den Achtzigern waren fast alle sprachlichen Äußerungen gesellschaftlich dissidenter hier aufgewachsener Menschen auf einen politischen Hintergrund bezogen. Die eigenen Lebensentwürfe waren – um sich von den kontaminierten der Elterngeneration abzugrenzen – zwangsläufig utopisch codiert. Jedes alltägliche Detail wurde auf seinen Bezug zu einem besseren Leben befragt. Das war für sehr viele Intellektuelle und Künstler auch ein Spielfeld – gespielt im Feld: „Ich denke mir andere Gesellschaftsmodelle aus“. Womit »der Alltag« systematisch überfordert war.
Die Entwürfe erwiesen sich nach und nach als wenig »lebbar«. So hat das öffentliche Sprechen sich von ihnen entfernt. Mit dem Wegfall des eisernen Vorhangs und der Überbetonung des »Siegs des Westens« verschwand der Bezug dieser Sprachtopographien und Denkmodelle auf real existierende politische Systeme. Der politischen Großrede, in der man von der eigenen revolutionären Verwandlung sprach, wurde der Boden entzogen. Zu groß war die Ernüchterung angesichts des schon in den 50ern von Albert Camus konstatierten Umschlags so vieler Revolten ins Reaktionäre. Die Verwandlungen eines Joschka Fischer zu einem reaktionären Militärbefürworter überraschten nicht mehr wirklich, sie ödeten nur an. Öffentliches Sprechen, soweit es aufrichtig ist, ist bescheidener geworden seitdem. Das Weichen der Großrede hat das Feld geöffnet für Reden auf einem weniger aufgeladenen Niveau, auf einem Pop-Niveau (das seine Aufgeladenheit dann allerdings heftig nachgeholt hat). Die Rede über Fußball profitierte von dieser neuen Spannungslage. Sie besetzte frei gewordene Kraftfelder im Diskursiven. Man kann das als ein Stück allgemeiner Zivilisierung ansehen. Es ist angenehm, dass nicht mehr jede/r in jeder Diskussion glaubt, dem Gegenüber erklären zu müssen, wie die Welt läuft; wie die Fußball-Welt läuft kann etwas entspannter diskutiert werden.
Das moderne Spiel. Digitalisierung
»Schnelle Ballstaffetten sind deshalb ein zentrales Kennzeichen, an dem wir das moderne Spiel erkennen«, schrieben die Fußballtheoretiker Christoph Biermann/Uli Fuchs in ihrem Buch Der Ball ist rund, damit das Spiel die Richtung ändern kann.
Das galt so bis ca. 2012; bis spanische Mannschaften wie Barcelona, die als höchste Verkörperung dieser Spielweise galten, mit einem Male nicht mehr unschlagbar schienen; Barcelona begann zu verlieren, das spanische Nationalteam folgte nach. »Tiki Taka«, wie diese Spielweise bald genannt wurde, der schnellen Ballberührungen wegen, galt mit einem Mal nicht mehr als der letzte Schrei. Es wurde etwas heruntergestuft zu »einem Mittel unter anderen«; behielt im Grunde aber seine Dominanz. Hinzugefügt wurde nur der überfallartige schnelle steile Gegenstoß, der die Lücke in der aufgerückten Viererkette findet und eine noch stärkere offensive Ausrichtung der Außenverteidiger, die seitdem mit Qualitäten von Außenstürmern ausgestattet sein sollten.
Was unterschied den schnellen Ballstaffettenfußball von den vorherigen Spielweisen?
Die Ballstaffetten waren und sind mehr als bloße effektivere Raumüberwindung. Often gelten sie gar nicht einem sichtbaren Raumgewinn. Sie können quer über den Platz gehen, sie können zurück gehen, jede Ballberührung und Weitergabe bedeutet auch: Der Gegner ist nicht am Ball. Ballbesitzfußball wurde das auch genannt. Das geflügelte Wort vom »Schwindlig-Spielen« ging vom Einzelspieler auf das Kombinationsspiel einer Mannschaft über: den Gegner ins Leere laufen lassen, indem man immer schon schneller abspielt als man angegriffen werden kann.
Bei diesem schnellen Abspiel entstehen Linien auf dem Feld, die, würde man sie sichtbar machen, eher ein dichtes Netz oder Geflecht von Linien ergeben würden, als die langen geometrischen Linien des alten Flugballspiels à la Johann Cruyff. Dort entstanden Tangenten, Dreiecke, lange Rechtecke, eine geometrische Mathematik auf dem Feld. Die schnellen Ballstaffetten des moderneren Spiels zeichnen keine geometrischen Formen, sondern Netzformen über den Rasen. Auf den Linien solcher Netze wird der Ball sozusagen nach vorn billardisiert, nach vorne gerastert könnte man auch sagen. Erst im letzten Moment, dem Moment des sog. »tödlichen Passes«, wo eine Lücke in der gegnerischen Abwehr entdeckt ist, wird er schnell in diese hinein abgespielt. Diese Endstation des Balls muß keineswegs die traditionelle »Sturmspitze« sein; Mittelfeldspieler oder Verteidiger gehen genauso. Ein Spieler, der die Schwachstellen im Netz des Gegners mit seinen Wahrnehmungskapazitäten erspürt, wird dadurch wertvoller als der Typ des bloßen Ackerers. Die gute oder schlechte Leistung eines Spielers bestimmt sich dann dadurch. wie gut oder schlecht seine Spielwahrnehmung sich in die der ganzen Mannschaft fügt. Seine Aufgaben sind deutlich komplexer geworden.
Mir erschien das schon vor Jahren als eine Verschiebung zu einer Art digitalen Anlage des Spiels hin, anstelle der vorher mehr geometrisch orientierten. Bei Jugendlichen, die heute von früh auf in Berührung mit elektronischen Technologien aufwachsen, bildet sich die Vorstellung einer »linearen Zeit« und die Vorstellung eines »perspektivischen Raums« (die für uns ältere eine gehirnliche Zwangsvorstellung ist) nicht mehr zwangsläufig aus – so der Medientheoretiker Vilém Flusser. Sie entwickeln auch nicht mehr das, was wir das historische Bewusstsein nennen; sie entwickeln nicht die Idee von einer »hierarchischen Tiefe« des Raums. Sie können sie nicht entwickeln, sagt Flusser, weil an die Stelle der alten Raum- und Zeitordnungskategorien der digitale Code tritt, das heißt ein Denken in Bildern und Formeln, das der alten alphabetisch-geometrischen Welt-Raum-Ordnung entgegensteht; und womöglich sogar mit ihr unvereinbar ist.
Auf der Buchstabenebene entspricht solcher Wahrnehmungsverschiebung das Faible der Jungen für die diversen Spielarten der Fantasy-Literatur, die in großen Zeit- und Raumsprüngen arbeitet und sich nicht mehr am alten Zeit-Raum-Kontinuum orientiert. Das leuchtet unmittelbar ein. »Historisches Bewußtsein« – dessen Fehlen den Jungen ja allenthalben attestiert wird – kann sich dabei kaum entwickeln. Mit Dingen wie dem Kurz- oder Langzeitgedächtnis hat das nichts zu tun. Die Entwicklung kündet von gehirnlichen Veränderungen, denen das »Geschichtliche« im alten Sinn schlicht nicht mehr kompatibel ist.
Es sind auch ganz andere Spiele anstelle der alten getreten; eine ganze neue Welt in den Sphären des Elektronischen ist entstanden, in der die Jungen sich bewegen wie der Fisch im Wasser; in der wir älteren zunächst festliegen wie der Fisch auf dem Trockenen.
Wenn die Hirnveränderungen, die Vilém Flusser (und inzwischen auch weitere Theoretiker) bei der jungen Generation als Folge radikaler Elektronisierung der Wahrnehmungs- und Denkvorgänge irreversibel eingeleitet sieht, so geschehen sind, dann müssen sie auch im Gehirn junger Fußballer ihre Spuren hinterlassen haben. Dann müssen sie auch in Taktik und Systematik des Fußballspiels selber sichtbar und erkennbar sein. Eben das wird sie tatsächlich in der »Tiki Taka«-Spielweise, die ich oben beschrieben habe. Das »Netz«, das die Linien des Balls auf das Feld zaubern, »entspricht« elektronisierten Netzwerken, wie sie sich in den Körpern der Spieler und in der Teamstruktur finden.
Das führt zur Frage, wie denn der Umgang der neuen Spielergenerationen mit dem Elektronischen beschaffen ist. Ein Testfeld, das sich anbietet, ist natürlich das elektronische Fußballspiel selber, das mit Spielconsole am Monitor gespielt wird; Copyright bei der FIFA, herausgebracht jedes Jahr neu mit jeweiligen aktuellen Veränderungen. Schon vor gut zehn Jahren wurde bekannt, dass Nintendo und andere Konsolen einen erheblichen Einbruch in das vorher flächendeckende Zocken mit Spielkarten bei den Fußballspielern auf Busreisen erzielt haben. Von der WM in Südkorea/Japan wurde berichtet, dass es eine mittlere Panik gab, als sich herausstellte, dass die europäischen Konsolen nicht ohne weiteres an die japanischen TV-Geräte anzuschließen waren. In einm Artikel von Malte Oberschelp im Magazin Elf Freundefand ich dann eine erste theoretische Betrachtung dieser Entwicklung:
In ihrer Verschränkung von Kommerzialisierung und Pop-Appeal bilden Computersimulationen die zeitgemäße Entsprechung zu einem Spiel, das sein Selbstverständnis als authentischer Volkssport längst hinter sich gelassen hat. Der Fußball und sein digitales Abbild sind eine untrennbare Symbiose eingegangen, in der die Grenzen verschwimmen. Sony wirbt seit 1997 als einer der Hauptsponsoren der Champions League für die PlayStation, der Hersteller Sega war in der Saison 2001/02 mit seinem Konkurrenzmodell Dreamcast auf den Trikots des englischen Meisters Arsenal präsent.
Oberschelp beschreibt die neue »Realitätsnähe« in diesen Computerspielen:
Die Kader der Teams sind mit den echten Mannschaften identisch, von Jahr zu Jahr werden selbst die Gesichter der Spieler ihren Vorbildern immer ähnlicher. Die Bewegungsabläufe werden von Stars aus Fleisch und Blut minutiös abfotografiert und dann von Dutzenden Programmierern grafisch umgesetzt, es kommentieren die aus dem Fernsehen bekannten Stimmen. Als Spieler kann man aus einer Fülle von individuellen und mannschaftstaktischen Möglichkeiten schöpfen. Auswechslungen, trickreiche Übersteiger, Abseitsfalle, Fallrückzieher und taktisches Foul? Gar kein Problem – solange man die entsprechende Tastenkombination am Controller nur flink genug parat hat. (…)
Heute bringen nur Spitzenteams solch genaue Pässe zustande, die daheim am Fernsehschirm längst gang und gäbe sind.
Mit anderen Worten: das Spiel an der Console kann komplexer sein und auch eleganter als das Spiel im Stadion auf dem Rasen.
Das brachte mich, als ich dies zum ersten Mal hörte, auf die spontane Feststellung: dann müsste selbst ein Michael Ballack oder Zinedine Zidane fußballerisch ja noch dazulernen können, wenn sie »sich selber« mit der Konsole spielen.
Sie zu fragen, hatte ich keine Gelegenheit. Aber der Fußballjournalist Christoph Biermann hatte; zwar nicht mit diesen beiden, aber mit einem Spieler, der noch aktiv in den Stadien herumzaubert. Christoph Biermann interviewte vor einiger Zeit Lionel Messi in Barcelona. Er hatte gehört, dass Messi auch ganz großartig an der Console sein soll. Und er hat ihn gefragt: Welcher Messi kann mehr, der auf dem Rasen oder der an der Console, wenn er von Messi selber gespielt wird. Messi habe nach einer kleinen Pause lächelnd geantwortet: der Messi mit der Console. Er sei z.B. dabei, einen bestimmten Schuß, den er mit dem »Messi« auf dem Monitor hinbekomme, im Training auf dem Rasen zu üben. Und da hat er ihn noch nicht geschafft. Das heißt, der körperliche Messi nimmt den digitalen Messi zum Vorbild bei der Verbesserung seiner fußballerischen Technik. – Hat mich gefreut, das zu lesen.
Wahrscheinlich sehen wir Samstag für Samstag in den Stadien oder im Fernsehen Proben dieser Umschaltung in Aktion. In den Spitzenteams erscheint diese neue Qualität als Fähigkeit, von fixen Spielsystemen abzusehen. Verschiedene Spielsysteme werden zunehmend kombiniert. Elektronisierte Spieler erkennen das jeweils Nötige besser und schalten entsprechend um. Bestimmte »Tugenden«, die früher bestimmten Nationen zugeschrieben wurden: »deutsche Tugenden«, italienische, holländische, spanische, französische, englische, ja sogar die »brasilianischen« liegen somit in Spielern aller Länder vor. Sie verfügen über ein Arsenal von Spielweisen, abgespeichert in ihrer Bewegungsstruktur sowie in ihrem zunehmend »digitalisierten« Gehirn.
Digitalisierung und »neue Körperlichkeit« greifen ineinander, auch ohne dass unbedingt ein »Chip« in den Körper eingepflanzt werden muss.
Und, was den Nationen bis heute so schwerfällt: anzuerkennen, dass sie im Prinzip nicht von anderer Art sind als ihre nächsten oder auch die ferneren Nachbarn: im Profi-Vereinsfußball ist dieser Schritt geschafft. Kein Bayer, soweit er Fußball-Narr ist, stört sich daran, daß zu den effektivsten (und auch zu den spielerischsten) Spielern ein Holländer und ein Franzose zählen, dazu ein Spanier und ein schwarzer Österreicher, neben drei, vier sporadischen Einheimischen; ganz hinten drin ein aus dem Ruhrpott geraubter Herr Neuer. Sie alle passen, verletzt oder auflauffähig – in dieselbe Kugel; in das All im Ball.
So dass ich, als ich zuerst über Fußball schrieb, vorschlagen konnte, den im Spiel der Theorien von Ernst Jandl ironisch auf eine bestimmte Gruppe von Lacanisten gemünzten Vers:
Phallus klebt Allus
ein wenig zu verändern; nämlich das »Ph« durch ein »B« zu ersetzen
Ein Vorschlag, dem »die Realität« allerdings nicht recht folgen will.
[1] »Nullnummer vor der Drohkulisse. Leipzigs Sportdirektor Rangnick warnt nach dem Spiel beim KSC vor den Auswüchsen des Fußballs«. Von Christoph Ruf. SZ, 11. März 2015
[2] »Ultras gegen Kamelreiter. Bei der ägyptischen Revolution kämpften Fußballfans an vorderster Front«, von James M. Dorsey. Le Monde diplomathique, 13. 1. 2012
[3] Nicht den wehenden blonden Haaren der jungen Mutter auf der Harley Davidson auf dem Desert Highway im Song von Neil Young
[4] »Demut auf der Baustelle«. Ulrich Hartmann, SZ 21./22. März 2015
[5] Deshalb wirken Spieler, die nach Torschuß ihre Kreuzchen küssen, so deplaziert auf dem Fußballfeld. Irgendwie demonstrieren sie in der falschen Kirche.
Im März 2015, erschien ganz neu: Das Lachen der Täter: Breivik u.a.
Residenz Verlag, Wien/Österreich
Aus der Buchreihe: UNRUHE BEWAHREN in Kooperation mit der Akademie
Graz;
Die Reihe UNRUHE BEWAHREN antwortet auf eine Gegenwartstendenz, die
immer ungemütlicher wird. Dem Fortschritt der Moderne wohnt eine Ver-
schleißunruhe inne, während die Vergangenheit zunehmend entwertet und
die Zukunft ihrer Substanz beraubt wird.
Vom Lachen der Killer wird in zahlreichen Fällen berichtet, aber selten wird es in
seiner zentralen Bedeutung gedeutet – so die provokante These dieses Psychogramms.
In den „Männerphantasien“ wagte Theweleit erstmals eine Beschreibung des
gewalttätigen faschistischen Mannes und seines innerlich fragmentierten, äußerlich aber
gepanzerten Körpers. Auf diese bahnbrechende Theorie greift er nun zurück, um die
brutalen Mordtaten zu untersuchen, mit denen uns die Aktualität täglich konfrontiert:
Anders Breivik, der selbsternannte Tempelritter, der 67 Jugendliche auf der norwegischen
Insel Utøya erschießt; die Killer des „Islamischen Staats“, die grausame Köpfungen im
Internet ausstellen; fanatisierte Attentäter, die die Karikaturisten von „Charlie Hebdo“
hinrichten; Kindersoldaten, die im Genozid an der Tutsi-Bevölkerung in Ruanda gelernt
haben, zu morden und zu vergewaltigen.
Ihnen allen gemeinsam ist „das Lachen der Täter“, in dem sich eine Tötungslust offenbart,
die die jeweilige politische Begründungssprache nur unzureichend verbergen kann.
Im März 2013 erschien: Pocahontas Buch II (CA): Buch der Königstöchter. Von Göttermännern und Menschenfrauen. Mythenbildung, vorhomerisch, amerikanisch.
Stroemfeld Verlag, Fft/Main
Buch I: PO
Pocahontas in Wonderland. Shakespeare on Tour, ISBN 978-3-87877-751-9
POCA 1 zeichnet die Geschichte der historischen Pocahontas: ihre berühmte (angebliche) Lebensrettung des rotblonden englischen Captains vor dem Tod auf Steinblock, ihre Hilfe für die Weißen in den ersten Wintern, ihre Geiselnahme 1613, ihre Taufe auf den Namen Rebecca und ihre Heirat mit dem Pflanzer John Rolfe 1614; die Züchtung des ersten nordamerikanischen Tabaks, der englischen Geschmacksnerven erträglich
war. Geburt eines Sohnes Thomas Rolfe, Pocahontas’ Englandreise 1616 und ihren Tod an der Themse 1617. Ihre Geschichte als »Urmutter aller Amerikaner«, wie die amerikanischen Künste sie in den Jahrhunderten danach entwerfen (das Gemälde von ihrer Taufe z.B. befindet sich in der Rotunde des Capitol in Washington).
Der zweite Strang des Bandes umreißt die Bedeutung, die die Jamestown/Pocahontas-Geschichte für Shakespeares letztes fertiggestelltes Stück The Tempest hat. Drittens: eine Bildergeschichte ›des Indianischen‹ von 1600 bis jetzt; (momentan vergriffen).
Buch III: HON
Kolonialismustheorien, oder: Warum Cortés wirklich siegte, ISBN 978-3-87877-753-3
(Frage, die inzwischen weitgehend beantwortet scheint), obwohl längst nicht alles gelöst ist bei Todorov & Co. (eher in den umfassenden Kulturbeschreibungen bei Jared Diamond oder Ian Morris). Es ist der ganze Packen der eurasiatischen (=»westlichen«) Kulturtechniken aller Ebenen (weit mehr als nur die überlegenen Waffen), mit deren Hilfe die übrige Welt seit der Conquista der Amerikas erobert und unterworfen wurde. HON zeichnet den Weg dieser Kulturentwicklung nach in einem zentralen Kapitel mit dem Titel »Gehirnsprünge« (unter Einbeziehung der Ergebnisse heutiger Gehirnforschung) und beschreibt ihre entscheidenden Techniken: Segmentierung, Sequenzierung, Konzeptualisierung; einsetzend mit der Haustierzucht ca. 10. 000 Jahre v.u.Z.,
über Metallschmelze, Schifffahrt, Vokalalphabet, euklidische Geometrisierung der Welt, Mathematisierung, Navigation, Renaissance-Perspektivismus hin zu den neuen technischen Medien um 1900ff. Antrieb und Produkt dieser Entwicklung ist die fortschreitende Atomisierung, inhärent all diesen Prozessen, bis hin zur Digitalisierung, der Teilchenpysik und der Nanotechnologie. Das europäisch-amerikanische »Subjekt«(das eben nicht nur keines ist, sondern auch nie eines war), ist ein Ableger dieser Technologien. Am Ende des Bandes steht ein Versuch der Neufassung des psychophysischen Baus des heutigen bei uns dominanten Menschentyps; basierend nicht in Freuds Personenmodell(en), sondern in einer Erweiterung seines Begriffs der Spaltung(en). (Erscheint 2014)
Buch IV: TAS
»You Give Me Fever«: Arno Schmidt. Seelandschaft mit Pocahontas.
ISBN 978-3-87877-754-0
POCA 4 Arno Schmidt. Seelandschaft mit Pocahontas, erwies sich als Text, an dem
sich der deutsche Nachkrieg, sein Verhältnis zu »Amerika«, zur Sexualität und zum
Umgang mit der sog. Vergangenheit vorzüglich darstellen ließ. Für uns zusätzlich das
Vergnügen einer ausgedehnten Kanufahrt – Tour de Dümmer – durch Arno Schmidts
literarische Geographien. (Lieferbar)
Soeben erschienen:
Buch der Königstöchter.
Von Göttermännern und Menschenfrauen
Mythenbildung, vorhomerisch, amerikanisch
Coverentwurf: Wolfgang Scheffler und Michel Leiner
Bild von Monika Theweleit-Kubale aus der Serie »Cremant-Collagen«
Satz: Doris Kern
Bildbearbeitung: Max Theweleit
Inhaltsverzeichnis:
Vorwort:
Mythenbildung, vorhomerisch, amerikanisch
Am Anfang war die Einwanderung 9
I. Medea, ohne Messer. Ovid. Apollonius.
Junge Frau im Selbstgespräch 15
Pocahontas Revisited, The True Story 43
Mord an Bord. Geburt eines Autors 76
Gerettet werden mit »weiblicher Hilfe« 96
Medea Zauberin 102
Griechische Mythologie: eine Sprachwalze 112
II. Göttermänner, Menschenfrauen.
Landraub über den Körper der Königstochter.
Mythogeographie 115
Objektwahl: Königstochter 119
Mythogeographie und Landnahme 125
Landkarte Tochterkörper. Königskinder 129
South of the Borders … East of the Moon 132
Look Homeward Angel. Apollos Home 136
Schon da? 141
Ledas Eier 144
Himmel, Astronomie, Tierkreise 149
Kuh werden; und andre bittre Wege. Beseitigung von Lokalherrschern 158
Großer Seitensprung: Europa (1) 169
Die Kykladen und ihre mythogeographische Umfunktionierung 174
Superheroes (1): Theseus; Poseidons Sohn 194
Auge und Telephos: das ägäische Kleinasien 199
Danaë und Perseus: Lybia. Gorgonen. Pegasus. Andromeda 204
Eurymede und Bellerophon: »Chimäre« Kleinasien 216
Ursprung: Mykene 219
Zwischenergebnis 224
Mischungspolitik 228
Um- und Sonderwege: Geschlechtswechsel. Kaineus und der Kentaurenkampf 229
Clan-Struktur & »erfundene Königstöchter« 241
Ohne Geburt: kinderlose Königstöchter 247
»Liebesverhältnisse«? 249
Sternbild werden & andere Gnaden 254
Ein Kontinent wird benamt (Europa 2): Ovid 260
Superheroes (2): Herakles 265
Zeitsprünge 269
Superheroes (3): Herakles aus Heinrich 284
Krankheit Mythos. Untersuchungsbefund: Ur-Sprünge 294
Die Götter übertrumpfen 302
III. Zwei Afrikanische Königinnen:
Kleopatra/Dido & Vergils Aeneis 324
Dido, am Wege 349
Objektwahl Venus-Sohn? 364
Mother Mary Come to Me 368
Tizian und Philip II. Schöpfungsmythen, Kolonisierungsmythen,
Aztekengold im Frauenschoß 380
IV. Medea, mit Messer
Medea in Athen. Euripides. Perikles und Aspasia 396
Seneca: Verwerfung des Kolonialismus und Fremdenhass 443
V. Malinche/Doña Marina & Cortés.
Neuer Kolonialismus und Die »Mestizaje« 461
Bernal Diaz erzählt 480
Cortés und Malinche vor Moctezuma 494
Malinches Kinder. Cortés Kinder 532
Malinches neue Töchter 550
Die Wahrheits-Seite; ohne Königstöchter 558
VI. Medea modern:
Grillparzer, Jahnn, Heiner Müller: Männerphantasien 563
Black Medea 570
Heiner Müller. Medeamaterial. 578
Ovid, der erste moderne: Briefe der Heroinen 591
VII. Pocahontas Digital.
James Cameron’s Avatar 615
Anhang
Anmerkungen 645
Bibliographie ( Auswahl) 710
Zu den Bildern 721
Vorwort:
Mythenbildung, vorhomerisch, amerikanisch
Am Anfang war die Einwanderung
Vor ca. 70000 Jahren begann der Auszug jenes Menschentyps, aus dem wir Heutigen resultieren, aus verschiedenen Teilen Afrikas: »Die letzte weibliche Ahnin, die allen Menschen auf der Welt gemeinsam ist, muß in Afrika gelebt haben – die afrikanische Eva, wie sie sofort genannt wurde«.
Über die arabische Halbinsel gelangen ihre Abkömmlinge nach Norden, Osten, Westen, überall hin. Soweit müssen wir nicht zurück für unsere Königstöchter-Geschichte. Nur bis etwa -10000, in die Zeit der ersten Ackerbauern im sog. fruchtbaren Halbmond (Teile der heutigen Türkei, Syriens, Iraks). Und hierhin auch nur, um kurz die Gesellschaftsform zu registrieren:
Siedlungen mit seßhafter Bevölkerung und fest aufgeteiltem Grundbesitz sind die materiellen Voraussetzungen für Königtümer und damit »Königstöchter«.
Wir steigen ein um ca. -2000. Größere Ströme indogermanischer Einwanderer strömen vermehrt ein von Nordosten in jene Gebiete, die wir bis heute als »Griechenland« kennen. Sie bilden die Population, die wir ab ca. -1600 als »Griechen« verbuchen: die Erbauer und Erzeuger der sog. »Palastkultur« von Mykene; jene Griechen, die ca. 400 Jahre danach, so um -1250, geschart um ihre Anführer, die Könige Agamemnon und Menelaos, mit ihrer versammelten Flottenstreitmacht aufbrechen nach Troia zu ihrem großen Krieg.
Am Anfang ist die Einwanderung: Aufbrechen mit Sack und Pack … Kind und Kegel … in Scharen, Horden, Gruppen … 350m pro Jahr … später dann ein paar Kilometer … From dusk till dawn … über Stock und Stein … durch Wälder, Wüsten und über Meere … entlang an Gebirgen … von Süd nach Nord … von Osten nach Westen. Ankünfte dort, wo immer schon wer ist … wo immer schon Menschen leben. Menschen in Bewegung treffen auf Menschen an Orten … mal diese auslöschend … mal sich vermischend. Die Erde ist eine Scheibe (und Gott ist eine Disc … geblieben bis heute). Jeden Tag ein paar Diskuswürfe weiter … weiter … in Jahrhunderten und Jahrtausenden … von Afrika in den fruchtbaren Halbmond … vor ins Mediterrane … von Vorderindien über »Thrakien« ins heutige »Griechische« … die »Donaukultur« durchquerend … das Zweistromland … Urstätten »unserer Kultur« … der eurasiatischen … (die Aufspaltung in »Abendland« und »Orient« ist eine späte Idiotie
… Produkt des römischen Imperiums … Folge seiner Spaltungen und despotischen Grenzwälle).
Die da jeweils ankommen, werden – mit einem ebenfalls römischen Wort – Kolonisten heißen. Sie kommen zu Fuß und mit Gerätschaften … Medien in den Worten Marshall McLuhans … »das Rad ist eine Erweiterung des Fußes« … sie kommen zu Pferd … auf Rädern und mit Schiffen … sie kommen metallbewehrt … und später mit der Waffe des Alphabets … zu Leuten, die über solches (meist) nicht verfügen. Sie kommen, um etwas mitzunehmen … das Goldene Vließ … oder um zu bleiben … also Alles zu nehmen … das Land zu nehmen, das sie erreicht haben. Einwanderung heißt, in aller Regel, Landraub. Die da kommen, sind übermächtig, aber nicht allmächtig. Sie brauchen Hilfen … und sie erhalten Hilfen … behaupten, später, die
Märchenerzähler, die Mythologen und Schriftsteller der Gold- und Landräuber. In den Erzählungen der eurasiatischen Kultur bildet sich eine Figur heraus von weiblicher Hilfe … eine Frau läuft über aus der Gesellschaft der kolonistisch Aufgesuchten … eine hohe Frau … eine hohe Tochter … die Tochter des Königs selber. Sie läuft über zum Anführer der Kolonisten … ergriffen von Liebe zu diesem. Sie heißt, zuerst, Medea. Medea ist die erste namentliche Menschin in Erzählungen des griechisch-europäischen Kulturkreises, die einem anderen Menschen, dem griechischen Seefahrer Jason aus Iolkos in Thessalien, nördliches Griechenland, zu dem verhilft, wonach er sucht, dem Goldenen Widderfell im Besitz des Königs Aietes, ihres Vaters; König der Kolcher – eines Volks am östlichen Ende des Schwarzen Meeres; »Rand der damaligen Welt«. Mit Medea und Jason muß dieses Buch, Buch der Königstöchter, beginnen.
Aber mit diesen beiden fing diese Geschichte nicht an; sie hat einen Vorlauf. Dieser Vorlauf ist uns durchaus geläufig; allerdings unter einem etwas irreführenden Namen. Er spielt auch nicht einfach unter Menschen; er spielt zwischen Göttern und Menschen; Göttern und Menschenfrauen; und heißt (in unserem historischen Bewusstsein) »Griechische Mythologie«. Die frühesten Erzählungen dessen, was wir heute »Griechische Mythologie« nennen, berichten von ortsansässigen Königstöchtern, die von Göttermännern, welche eine einwandernde Population mit anschleppt, beschlafen und geschwängert werden; meist gegen ihren Willen (oder auch im Schlaf); die also vergewaltigt werden von der neuen Gott-Kohorte mit den Namen Zeus, Poseidon, Apollon, Dionysos; mitgebracht von einer Masse aufs Vierfingerland einwandernder Indogermanen, der späteren »Griechen«; wobei die einheimischen Könige, die Väter dieser Töchter, um ihr Land gebracht werden. Den Schicksalen dieser Königstöchter – ca. 30 an der Zahl – gilt der Mittelteil dieses Buchs. Eine dieser Königstöchter trägt bekanntlich den Namen Europa; von Zeus in Stiergestalt aus Phönizien entführt und auf Kreta geschwängert. Eine andere den Namen Helena – aus einem der Eier geschlüpft, die der Zeus-Mann als Schwan in die
Königstochter Leda gelegt hat. Andere tragen die Namen Antiope, Io, Ariadne; Danae – wir kennen sie aus den Bildtiteln der Renaissance-Maler. Deren Bilder werden anzuschauen sein.
(Fußnote: * Eine weitere Bildschiene dieses Bandes bildet das Design von Zigarettenschachteln: die Bildkunst, die gefolgt ist aus Amerikas erster großer Industrie, Tabak. In Band 1: Pocahontas in Wonderland. Shakespeare on Tour gibt es die Bildschiene der frappanten Einarbeitung indianischer »Motive« ins Design amerikanischer Firmenlogos, Zeitungslogos, Logos von Baseballclubs etc. Hier nun folgen die Meisterwerke auf den Schachteln zweier großer Tabakkonzerne: Regie Française (Gauloise, Gitanes) und Philip Morris. Deren Designer (die offenbar eine zeitlang allergrößte Narrenfreiheit genossen), erweisen sich als profunde Kenner aller Arten von Kolonialgeschichte(n).)
Den ersten Kolonisten der Neuzeit, den Kolonisten der postkolumbianischen Amerikas, dem Capitano Hernán Cortés in Mexico und dem Captain John Smith in Virginia sind die griechisch-römischen Mythologien wie auch ihre Renaissance-Versionen wohlbekannt, als sie in ihren zu erobernden Kontinenten ebenfalls ihre »Königstöchter« finden, die zu ihren Helferinnen werden; an vorderster Stelle die Aztekin Malinche, Tochter eines aztekischen Unterkönigs und die Algonquinfrau Pocahontas, eine Tochter des obersten »Chief«, des »Königs Wahunsenaca« der Powhatan-Indians im nordamerikanischen »Virginia «. Letztere, so die tradierte anglo-amerikanische Legende, falls in love mit ihrem Kolonisten John Smith; um dann von ihm »verlassen« zu werden – (wie die asiatische Medea von ihrem Lover Jason). Erstere, die mexikanische Malinche, dient ihrem Herrn Cortés real als unersetzliche Dolmetscherin; sowie in der Legende als seine Geliebte. Sie gebiert dem Cortés in der Tat ein Kind. So wie die Pocahontas ihrem weißen Ehemann, dem Tabakpflanzer John Rolfe. Ein bemerkenswerter historischer Dreh: die »mythologischen« Figuren der griechischen Frühgeschichte konvertieren im 16. und 17. Jahrhundert der Neuzeit zu lebendigen Figuren der aktuell laufenden Realgeschichte, der Kolonialgeschichte der von Spaniern, Engländern, Franzosen, Holländern, Portugiesen etc. kolonisierten Americas. Allerdings ist dieser »Dreh« eine Erfindung nicht erst der neuzeitlichen Kolonisten. Wir erkennen ihn schon beim römischen Staatsdichter Vergil. Vergil in seiner Aeneis bringt in der mythischen Königin Dido von Karthago (einer Ablegerin der Medea-als-Helferin) eine reale Königin laufender römischer Geschichte unter: die Königin Kleopatra aus
dem nordafrikanischen Alexandria. Deren ptolemäisches Königreich wird dem römischen Imperium im Jahr -29 kolonistisch einverleibt, nachdem Kleopatras real angestrebte politische Koalitionen mit den römischen Herrscherfiguren Gaius Julius Cäsar und Marc Anton (von denen zusammen sie vier Kinder hat) großartig gescheitert sind; sie bezahlt mit dem Leben – und wird umgearbeitet von Vergil in die karthagische Dido, die große Helferin des mythischen Begründers des römischen Imperiums: Aeneas.
Dem Vergil in solcher Konstruktion vorausgegangen ist der griechische Dramatiker Euripides. Dieser bringt in seiner Medea im Jahr -431 Teile einer Frau des aktuellen Athener Moments unter: Teile der realen Geliebten seines Staatschefs Perikles, der Nicht-Griechin Aspasia, der in der athenischen Realität ebenso die Ausweisung als Ausländerin droht wie der Medea des Theaterstücks die Ausweisung aus Korinth. Man gelangt, zwingend, zur Wahrnehmung, daß die verschiedenen Geschichtssorten, die sog. mythologische wie die sog. Realgeschichte, erzählerisch, schriftstellerisch, malerisch wie kolonial-politisch permanent ineinander übergehen – schon seit ein paar Tausend Jahren. Dieses Buch untersucht einen speziellen Vorgang daraus: die Fälle realen, mythologisch »verbrämten« kolonistischen Landraubs, durchgeführt über den Körper von Königstöchtern, die von Göttermännern bzw. vom Kolonistenführer beschlafen werden; was dieser Spezies zur
Legitimierung ihres Landraubs dient. Die Töchter der frühen prä-griechischen Könige des ägäisch-ionischen Raums, Medea sowie die nordafrikanische Dido sind seine mythologischen Hauptfiguren; untrennbar von den Körperlichkeiten der realen Aspasias, Kleopatras, den Körpern der Malinche und der Pocahontas, diesen Protagonistinnen kolonialer Realgeschichte«.
Der etwas schlichte Vorwurf an die Adresse der Americas – insbesondere seinen dominanten Nordteil – seinen Bewohnern fehle jedes »Geschichtsbewußtsein«, weicht heute zwar zunehmend der Einsicht, Amerikas Geschichtsverständnis realisiere sich in einem Konglomerat aus Geschichten, Mythen, Songs und Filmen; alle eng verbunden mit amerikanischen Schauplätzen. Literarische sowie historische Aufzeichnungen seien lediglich als deren Ergänzungen zu betrachten.*
Überraschend ist dagegen die Wahrnehmung, daß es sich mit der frühen »europäischen« Geschichtsschreibung gar nicht anders verhält. Sie bildet ein ebensolches Konglomerat aus Geschichten, Mythen, Orten,Malereien, Epen und Songs – bloß daß, selbstredend, Filme eine gleichartige Rolle nicht spielen konnten bei der Ausformulierung der »Griechischen Mythologie(n)« als realer Kolonialgeschichtsschreibung.
(Fußnote: * Zumal ein Löwenanteil historiographischer »Beweisführungen« heute an berufsmäßige Ausgräber übergegangen ist. Würde ich noch mal anfangen, als angehender 20-jähriger Spurensucher in den Geschichtswüsten, man fände mich wohl unter den Archäologen).
Die Geschichten der frühen »griechischen Mythologien« als Begleiterzählungen realen Landraubs: in der Tat lassen sie sich kartographieren, folgt man den diversen geographischen Hinweisen und Angaben; insbesondere der Verbindung bestimmter Königsnamen mit bestimmten Landschaften. Es ergeben sich handfeste mythogeographische Landkarten kolonialer Landnahmen, durchgeführt über Planeten Pandora »irgendwo« im Weltall. Aber der Mars ist nicht länger out of the way. Und in Afrika toben nicht einfach »Stammeskriege«. Zwar mag es vergebliche Liebesmüh sein, den Fantasies der laufenden Elektronisierung aller gehabten Geschichte(n) exakteren historischen Boden einziehen zu wollen; aber den Versuch (das Vergnügen) war es mir wert. Daß Bücher letztendlich nichts mehr bedeuten – diese Last ist immerhin von ihnen genommen – kann zu ihrem Vorteil ausschlagen; zum Vorteil der Gewichtslosigkeit, selbst wenn 1 Kilo schwer. Bücher können schweben. Nicht so die fortdauernden Kolonialismen jeder Art – deren Gewichte sind tödliche und durch gar nichts zu mildern. Sie haben noch jedes Buch in Blut getaucht (was Bücher überleben), nicht aber die beteiligten Menschen. Wann diese endlich aufatmen dürfen unter den Bedingungen des vom herakleischen Bazon Brock unentwegt geforderten »Ernstfallverbots« (=Null-Tote-Doktrin) steht in den Sternen (und nicht mal da).
***
Im März 2011 erschien: How Does It Feel. Das Bob Dylan Lesebuch,
Hg. von Klaus Theweleit bei rowohlt/Berlin.
Vorwort zum Bob Dylan-Reader:
Billie, Elvis, Bob…unlöschbar
Dunkelheit zur Mittagszeit (nicht Dunkelheit zur Mitternacht) beschert uns die erste Zeile von Bob Dylans Song It’s Alright, Ma (I’m only bleeding) – dem Stück, das mir immer als Dylans »persönliche Nationalhymne« erschienen ist oder, besser, als seine Declaration of Independence: Darkness at the break of noon –
– drei schwergewichtige Wörter: darkness – break – noon, die Einiges transportieren im Amerika des Jahrs 1965. Darkness at Noon ist der amerikanische Titel von Arthur Koestlers berühmtem Roman Sonnenfinsternis. Das Wort »noon« ist zusätzlich aufgeladen durch High Noon, den Modell-Western (dt.: Zwölf Uhr Mittags) von Fred Zinneman, in dem Gary Cooper, verlassen von allen und nur leidlich unterstützt von seiner Frau Grace Kelly, gefordert ist zum Duell »eins gegen drei«: drei überlegene Bandidos, die die böse Eisenbahn ausspuckt an der menschenleeren Railway Station kurz vor zwölf. Song: Do not forsake me, oh my Darling. Dylans Formulierung break of noon ist gleichbedeutend mit High Noon, Stunde, da das Showdown anbricht, Stunde der Entscheidung »Gut gegen Böse«. You see, something is happening here, but you don’t know what it is. Do you, Mr. Jones?
Ich jedenfalls wusste nicht. Von Arthur Koestlers Roman Sonnenfinsternis – dieser Abrechnung des abtrünnig gewordenen Ex-Kommunisten Koestler mit dem Kommunismus/Stalinismus – hatte ich zwar reden hören in der Schule (von einem netten antikommunistischen katholischen Englischlehrer namens Hucke). Koestlers Buch von der politischen Sonnenfinsternis (was die »Freiheitserwartungen durch Sozialismus« betrifft) mit Dylans Songzeile in Beziehung zu setzen, wäre mir aber nie in den Sinn gekommen, 1966, als ich den Song zum ersten Mal hörte. Wer wusste schon in Deutschland, dass Koestlers Buch in den USA Darkness at Noon heißt; Dylans Zeile also ein Halbzitat war.
So kam auch niemand (den ich kannte) auf die Idee, dieser amerikanische junge »Protestsänger« würde zur Gitarre Texte montieren, nicht anders als andere moderne Lyriker – die man ja verschlang zwischen Frühstück und drei Uhr nachts als junger Lyrik-Fan zwischen Gottfried Benn, Ezra Pound, Baudelaire und Dylan Thomas. Obwohl die nächsten Zeilen von Bob Dylans Song ja solches – beinah demonstrativ – nahelegen:
The hand-made blade, the child’s balloon – – die handgeschmiedete Klinge – auf wen sollte die wohl weisen, wenn nicht auf King Arthurs oder gar Siegfrieds Schwert? Ja, natürlich, Siegfrieds Schwert aus Fritz Langs Nibelungen – Stummfilm, den hier zwar niemand kannte (niemand kennen konnte), wohl aber interessierte junge amerikanische Kinogänger im Greenwich Village, Manhattan, New York. Und beim child’s balloon sind wir absolut in Fritz Lang: welcher Luftballon sollte das denn sein, wenn nicht jener, den Peter Lorre, der Kindermörder in Langs »M« dem kleinen Mädchen in die Hand drückt, das
dann bald tot aufgefunden wird: Peter Lorre, einer der populärsten Hollywood-Stars aus der großen Schar der Emigranten, die Hollywoods Kino so sehr geprägt haben. Emigrantenbezüge. In der folgenden Zeile von It’ Alright Ma dann Dylans kühne Überbietung von Arthur Koestlers Bild:
Eclipses both the sun and moon –
– eine Dunkelheit, die die Sonne und den Mond zugleich ausknipst: right now, im Amerika des Kalten Kriegs (& des heißen Kriegs in Vietnam). Finsternis, wohin das Auge sich wendet. Worauf die Strophe einmündet in die erste radikale Bestandsaufnahme des politischen Moments wie des persönlichen Moments des Sängers:
You understand you know to soon/there is no sense in trying –
– zu früh kapiert (als grad dreiundzwanzigjähriger Folkmusic Hero), dass das alles hier keinen Sinn hat; dass es die Mühe nicht lohnt: Gib’s auf, lass es bleiben. Solche Töne hatten wir, in der deutschen Diaspora, auch im Ohr, eingeprägt vom irisch-französischen Existentialisten Samuel Beckett, dem kalten, unnahbaren. Bei Dylan klang es näher, näher am eigenen Leib: You discover that you are just one more person crying
– was hieß, und man verstand bestens, Gib nicht so an, du bist bloß einer mehr, der entdeckt, dass es zum Heulen ist. »Es«: das Leben (= America at the break of noon).
Die Reimworte der dritten Strophe: door/war/roar/before/more, klanglich alle auf „-ore“, hätte ein aufgeweckter Lyrikkopf dann ohne weiteres komplettieren können mit „Nevermore“, dem aufgeladenen Reimwort der ewig nachhallenden Refrainzeile von Edgar Allan Poes The Raven, grad auswendig gelerntes Modellgedicht für Lyrik-Sound : Quoth the raven: nevermore. Bei Dylan:
… you follow find yourself at war
watch waterfalls of pity roar
you feel to moan but unlike before
you discover that you are just one more
person crying.
Es war also keineswegs so – und heute weiß man dies definitiv – dass dieser smarte lockige Jüngling auf den Plattencovern, nicht mal ein Jahr älter als man selber, seine Songzeilen einfach aus den eigenen Gehirnwindungen klaubte. Er hatte gehört, gesehen und wie wild gelesen; er bastelte und montierte in seine Songs, was ihm über den Weg (und über die Leber)
gelaufen war bis dahin. Bloß: Koestler – in der kommunistischen Linken, auch der New Yorker Linken, verschrien als »Renegat« – was hatte Dylan am Hut mit diesem Frontenwechsler im Jahr 1965? Er hatte, mehr als ’ne Menge. Dylan wusste, wie es sich anfühlte, „Verräter“ genannt zu werden. Gerade hatte er mit seiner vierten Platte, Another Side of Bob Dylan, die auf politische Folksongs geeichten Anhänger des ersten Dylan-Ruhms verstört und verärgert, da folgten mit seiner fünften Platte, Bringing it All Back Home, seine ersten Ausflüge in die Welt des elektrifizierten Rock: womit er für die akustischen Folkies (mindestens) des Teufels war: übergelaufen in ein feindliches Lager. Jonathan Lethem bringt Dylans Permanentverrat auf die kürzeste Formel, erinnernd an »jene, die sich in den 60er, 70er Jahren regelmäßig von ihm betrogen fühlten – Elektrisch! Country! Hausmann! Privatier! Christ!« Kabel wurden durchschnitten Mitte der 60er, es wurde gebuht und gepfiffen, und schließlich schallte Dylan die Anklage „Judas“ entgegen aus einem Konzertsaal: ihm, einem jungen ehrgeizigen jüdischen Musiker, Mitte Zwanzig, der alles andere sein wollte, als grad mal »Jesus«. Einem, der vor allem Musik machen wollte; allerdings Musik aus und mit den Konturen seiner eigenen Lebensmomente, verbunden mit denen des geschichtlichen Moments.
Greenwich Village war ein linkes Nest Mitte der Sechziger, mit mehr »dogmatischen« als frei denkenden Linken. It’s Alright Ma bringt das, was man in politischen Terms »Lagerproblematik« nennen würde und die Loslösung von ihr, bündig auf den Punkt: That it isn’t he or she or them or it that you belong to – dass du nichts und niemandem zugehörst, weder Personen noch Parteien, nicht politischen Systemen und nicht gesellschaftlichen Gruppen. Woraus folgt, was das (geforderte) politische Engagement angeht: I’ve got nothing Ma, to live up to.
Dies alles ist existential-politisch derart klargestellt schon in diesem Song auf der Platte Bringing It All Back Home, März 1965. Tatsächlich findet sich im Wikipedia-Kommentar zu dieser Platte der schöne Satz: »It’s Alright Ma ist für den Kapitalismus das, was Koestlers Darkness at Noon für den Kommunismus war«; Kompliment, ein helles Ohr. Aber, so geht Dylans Song weiter: das macht gar nichts. Ich muss niemandem zugehören, den Im evozierten Namen Fred Zinneman, Regisseur von High Noon, außerdem der Anklang an den eigenen Namen, Robert Zimmerman, aus dem der Sänger (jüdisch) grad ausgewandert ist in den Namen Bob Dylan: Folkies nicht, Joan Baez nicht, den Hobos auf dem Highway nicht und nicht den Organisationen der rebellischen Studenten, auch wenn ich mit ihnen sympathisiere; denn: It’s alright Ma, I can make it.
Ich komm klar, auch ohne sie und ohne das alles. Bloß: wenn man meine Gedanken lesen könnte, würde man meinen Kopf unter eine Guillotine legen. Das ist das Risiko:
But it’s alright Ma, it’s life and life only.
Ein Bilanzsong also „im 24. Jahr“ voller persönlicher, politischer, literarischer Bezüge und selbstverständlich auch musikalischer: denn dass It’ Alright, Ma nur eine leichte Abwandlung jenes Titels ist, mit dem King Elvis zehn Jahre vorher seinen ersten Radiohit landete: It’s Alright, Mama, ist selbstverständlich der Garde der Rock-Autoren nicht entgangen. Aber Dylans Spannweite umfing immer schon mehr als die Felder der Bluesroots, des American Folk Songbook, der Rock ’n’ Roll-Poesie eines Chuck Berry oder der American Musicals. Auch der (zutreffende) Verweis auf die Autoren des europäischen Surrealismus deckt nicht das ganze Spektrum ab. Die Wortkrake Dylan hat ihre zehn Schreibmaschinenfinger in allen Wörterseen aller Nähen und Fernen, im selben Wordpool, in dem die Lyriker der klassischen Moderne die Wässer aufleuchten ließen oder auch trübten; so dass jene Legenden-Version, die den walisischen Lyriker Dylan Thomas als Spender des neuen Namens für Young Robert Zimmerman angibt, die größte Plausibilität unter den umlaufenden Versionen hat. Zumal jener Dylan Thomas in New York als Frühvollendeter (alkoholisch) verendet war; in jenem kalten Winter-New-York, in das der junge Robert Z. aus Hibbing/Minnesota 1961 eingefallen war, um Bob Dylan zu werden. Es gab etwas fortzusetzen an der Arbeit des verehrten toten Wortzauberers.
Darüber hinaus versieht der junge Bob Dylan in It’s Alright Ma gewisse Erwartungen, die er und andere an ihn haben (oder hatten) mit einer Warnung an sich selbst. Man habe versucht, ihn hineinzuquatschen, ihn hineinzuwerben in die Position eines jener großen Einzelnen, der hinkriegen könne, was noch nie jemand hinkriegte. Sie haben gesagt, er sei der Eine, er sei
The One
That can do what’s never been done
That can win what’s never been won
Meantime life outside goes on
All around you –
– schaffen was noch niemand schaffte; tun was noch niemand getan. Zeilen, die absolut exakt die Grandiositätsphantasien aller aufbrechenden vielversprechenden Zwanzigjährigen formulieren. Phantasien, die nicht damit überwunden sind, diese Position kühl von sich zu weisen. To do what’s never been done ist einer der Hauptantriebe aller aufbrechenden Jungen,
besonders derer, die aus irgendeiner Small Town irgendwo im hinterwäldlerischen Amerika aufbrechen nach New York – mit der Absicht (oder Gewissheit) to make it there.
Heute ist Dylans Art der bezugsgeladenen Wörtervernetzung zumindest seinen Anhängern gut bekannt. Im Netz findet man, sobald eine neue Dylanplatte erscheint, nicht nur deren Texte, sondern sofort ein Riesenkonvolut an Begleittexten, die säuberlich die benutzten Quellen und eingearbeiteten Textstellen der neuen Songs aufspüren und benennen. Mit beeindruckendsten Resultaten: Im Song Thunder on the Mountain auf der Platte Modern Times (2006) gibt es die Zeile
I been sitting down studying the art of love/I think it will fit me like a glove – die Kunst der Liebe würde ihm passen wie ein Handschuh, sagt der Sänger. Der Internetkommentar vermerkt, dies sei ein Bezug auf Ovids, des alten Römers, ars amatoria, Ovids Schrift von der Liebeskunst. Bon! Aber in der Strophe und dem ganzen Song finde ich keinen weiteren Bezug auf Ovid. Offenbar liegt heutigen Dylan-Spezis die Idee fern, dass man mit der art of love (die Dylan passe wie ein Handschuh) auch ohne Ovid-Bezug etwas anfangen könne. Was für eine Karriere des Pop- Weisen also im Feld jener Leute, die sich »vom Wort die Hand auflegen lassen«.
Aber – was wären Dylans Texte ohne die Stimme.
THE VOICE. Die Stimme ist es…die Stimme…wie man es auch dreht…dann erst die Gitarre… der Klang der Band…das Amalgam aus E-Gitarre(n), Orgel, Mouth harp, Bass & Schlagzeug, Piano oder Violine. Zuerst die Stimme…dann erst die Erscheinung…Haare, Augen, Sun glasses…die ausgeflippten Hemden…die Art, die Beine in die Gegend zu stellen…das wissende Grinsen…so oft man auch wieder hinsieht…hinhört…die Texte durchgeht…wunderbare Sachen…sicher ist Dylan der profundeste aller Songtexter…der präziseste: Your sons and your daughters are beyond your command! Welche Zeile hätte exakter die Kündigung des Generationenfriedens enthalten, die Anfang der 60er an die eigenen Eltern, die Eltern der Weltkriegsgeneration (der Westwelt) seitens ihrer Kinder erging: Ihr habt keine Macht mehr über uns – solche Milestones wie auch die ganze roadmap for the soul (Dylan in Tombstone Blues) liegt ausgebreitet da im Textkorpus…aber ohne die Stimme ist es nur die halbe Lyrik…es bleibt bei der Stimme…ihrer absoluten Unwahrscheinlichkeit…das genau ist das Wort für die Komplettheit des Ausbruchs…wie bei Billie Holiday und Elvis…das Unwahrscheinliche hält Einzug unter die Realitäten. Eine weitere solche Einzelstimme fällt mir nicht ein …vielleicht noch, für Momente, Ray Charles…King Ray …etwas Universelles einiger weniger Stimmbandbesonderheiten…überbordend von Geschichtshaltigkeit…Wissens- und
Gefühlsschichten…ein höchst Seltenes, Verdrehtes, Skurriles und Allgemeines zugleich…der direkteste Weg in die Körperzentren…
She never stumbles/She’s got no place to fall:
– nicht nur die Zeile für die vollkommene Frau, die Dylan »artist« nennt…der nichts fehlt…nein, das ist die Zeile für die Stimme selber…für den Flügelschlag des Unerhörten…und mit einem Mal Selbstverständlichen…sowie höchst Artifiziellen…etwas vorher nicht Vernommenes…ein Kondensat aus der Überwirklichkeit…ein Wunder im Physischen, das die großen, die unvergleichlichen Stimmen macht Billie Holiday der dreissiger und vierziger…Elvis der fünfziger…Dylan der sechziger Jahre…dann lösen sie sich daraus…werden Stimmen einer Epoche…enthalten ein halbes Jahrhundert… manchmal mehr, enthalten vor allem die Sekunden, die Mikro- wie die Makrosekunden, in denen eine Generation, ein Land, ein
geschichtlicher Zustand »zu sich kommen«. In Dylan war zu hören, ist zu hören und wird einst zu hören sein, was jeweils aktuelle Geschichtsvernichter zu löschen versuchen aus der Aufzeichnung der Revolten der Generationen überhaupt und insbesondere der Generationen nach Weltkrieg II: die Verabscheuung des Kriegs…die Vergötterung des Sexuellen…das aushäusige Leben, »the road«…der Glaube an die Musik…die Plazierung der Kunst und der Körper über den Ansprüchen aller Polit-Realitäten…aber auch den Zusammenbruch der Illusionen.
All your seasick sailors they are rowing home…
– von hier, aus den Rillen der Stimme, werden sie es nicht löschen können. Die Unwahrscheinlichkeit der Momente einer sich drehenden Weltsituation liegt, unlöschbar festgehalten, in der Stimme von Bob Dylan. The Voice.
Amerikas tiefste Weisheit: It’s the singer not the song, seine alte (untrügliche) Formel für die Wahrnehmung exzeptioneller Stimm- und Soundbefindlichkeiten, muss seit Dylan erweitert werden: It’s the singer a n d the song. Etwas hob an, das es in Kehlen und Songs vorher so nicht gab; eine Singer/Song-Verschlingung wie selbst bei Billie Holiday nicht; denn ihre Songs
wurden von Allen gesungen, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Lena Horne, ohne dass dies Cover-Versionen gewesen wären; Allgemeingut der schwarzen Kneipen- und Dance- Hall-Szene. Die Singer/Songwriter-Koppelung war etwas Anderes, unabweisbar neu. Und so unabweisbar poetisch, dass selbst Allen Ginsberg, poetischste Stimme der Beat-Generation, vor Neid erbleichte und in Bewunderung ausbrach; aus der dann bald eine enge Freundschaft wurde.
Dylans Lyrics sind »surrealistisch« genannt worden; das ist zutreffend, wenn man dies Wort angemessen auffasst. Denn mit dem Wort »surreal« bezeichneten die französischen Surrealisten eine umfassendere Wirklichkeit: die Welten der Objekte, der Bilder, der Gefühle, der Räusche und insbesondere des Traums gleichermaßen einschließend…eine wirklichere
Wirklichkeit. Diese nannten sie die surreale & in diesem Sinn ist Dylan ein Surrealist…nicht wegen ein paar »verdrehter« Zeilen seiner Songs. Und seltsam, oder vielleicht gerade nicht seltsam, nirgendwo außer in einigen Jazz-, Pop- und Kinostücken ist diese umfassendere Wirklichkeit tatsächlich wirklich geworden oder wirklich geblieben. Dylans unwahrscheinliche Pop-Stimme ist einer der Orte ihrer vollkommenen Materialisierung…nicht zu finden in den Büchern unserer Top-Ten-Philosophie-Beamten…da ist eher kühles Valium…verabreicht Lesern, die die Power des (Sur)Realen nicht ertragen…den Klang der Wirklichkeiten…Leute, die sich zu den Denkern flüchten…und denken, da sei was…Entertainment für Anspruchslose. Ich jedenfalls tausche den ganzen Suhrkamp-Laden gegen die gesammelten Columbia Records.
Test: Man kann sicher sein, jemand, der auf Bob Dylan nicht flog, wird als erstes sagen, wenn gefragt: Ich mag diese Stimme nicht…dann kommen Wörter wie »dies Knarren, Quetschen, Drücken, Zerren«…dies Ätzende…eine Abstoßung (Anziehung) wie nach Gravitationsgesetzen…die Ozeane & der Mond…die, die nicht der Ozean sind, folgen der Anziehung des Mondes nicht. Von den Stimmen Sinatras, Ella Fitzgeralds, Neil Youngs, der Callas wird man nur annähernd Gleiches sagen können…von der Garde der mafiösen Tenöre zu schweigen…auch nicht von den Beatles, obwohl sie nahe kommen…da ist es das Ensemble…die Boy Group Electricity…der losgebundene Gitarrengaul…die vervierfachte Jugendlichkeit… unbekümmert bis in die Schuhsohlen – – aber es gilt für das Becken von Elvis und seine narkotische Lippe…den Haarschwung…für Billie Holidays schwarze Stirngardenie… die melancholische Schönheit ihrer erotisierten Trauer…den Klang Song-gewordener Emanzipationsgeschichte, nicht nur schwarzer und weiblicher. Sie hat die Stimme, die den historischen Stand des menschlichen Ohrs »1939« beschreibt, soweit dies kein kriegerischer war: »Alles was man je sagen wollte, hatte sie schon gesagt, schöner, genauer« Dieser Satz von Amiri Baraka behält seine Gültigkeit; wie für Dylan 1965.
Seit den Zwanziger Jahren sind Teile der europäischen (weißen) Welt und der amerikanischen sowieso unaufhörlich übergelaufen zu den (schwarzen) Musik-Emanzipationen. Der junge Spanier Luis Buñuel kauft sich ein Banjo, 1925, als die neue amerikanische Musik sein katholisches Studentenohr in Madrid erreicht (später ein großer Surrealer). Paris läuft über zu Josefine Baker und selbst Killertypen wie Hermann Goering, deutscher Fliegermarschall und Drogenmensch, übergibt die konfiszierten Platten mit »Negermusik« nicht der Schrottpresse, sondern seinen privaten Regalen: größter deutscher Jazzsammler (wie auch Sammler enteigneter »entarteter« Gemälde). »Music is the healing force of the universe« befand Albert Ayler auf einem brüllenden Saxophon; mit dem Ton tausender gebündelter schwarzer Stimmen. Für Myriaden gequälter (schwarz-weißer) Seelen war (und ist) music diese Kraft…aus einer Handvoll menschlicher Universalstimmen, auf die sowohl Sternen- als auch Erdenstaub fiel…Stimmen mit unendlicher Aufzeichnungsbreite für alles, was ist…Überbrücker von Abgründen…Abgründen in den Personen, Abgründen zwischen den Personen…Abgründen der Geschlechter, der Hautfarben. Die Nazis waren sogar gegenüber dieser Heilkraft immun.
Aber, diese Stimmen öffnen auch Abgründe…Abgründe des Absehens und Wegsehens von der Welt…Abgründe des Leichtsinns und der Unverantwortung…Abgründe des Verrats und der Verschwendung.
I must have been mad
I didn’t know what I had
Until I threw it all away.
Auch diese (Selbst)Anklage hat niemand klarer und schmerzhafter formuliert und moduliert als Dylan. Zeilen, ausdehnbar auch hier auf »die ganze Generation«: We must have been mad. Wir wussten nicht, was wir hatten. Bis wir es weggeschmissen haben.
Unter Verwendung genau dieser Zeilen hat Greil Marcus im Jahr 1974 eine surreale Bühnenvereinigung der Existenzen von Elvis und Bob Dylan phantasiert: »Alles in allem bleibt nur noch ein Moment, den ich gern erleben würde; eine Offenbarung, die irgendwie Elvis’ Geschichte abrunden würde. Elvis käme auf die Bühne, wie er es immer getan hat; das Gebrüll des Publikums würde ihn umtosen, wie es das immer tun wird. Nach einer Weile würde er mit einem Song von Bob Dylan anfangen. Er würde langsam singen und alles, was er hat, in den Song hineinlegen: „I must have been mad“, würde er klagen, „I didn’t know what I had – Until I threw it all away“. Und dann würde er, mit Liebe im Herzen, lachen«. Die reale Realität (die kastrierte) sah anders aus: Elvis vegetierte im weißen Ganzkörperanzug angekettet in Las Vegas; Bob Dylan kam heraus mit Blood On The Tracks und startete einen neuen Anlauf: Back to the stage. Konzerttourneen hatte er aufgegeben nach seinem Motorradunfall von 1967. 1974 sieht Elvis und Dylan jeden in seiner eigenen & beide in einer komplett anderen Welt. Aber: Wenn es überhaupt einen Zustand gibt, wo man das Weggeworfene und Verschwendete des eigenen Lebens in einer Art spiritueller Materialität wiederbekommt, ist es in solchen Stimmen und ihren Verschlingungen. Und dann wird es
auch woanders noch vorkommen; so ruft, unermüdbar und untötbar, das sogenannte Prinzip Hoffnung dazwischen. Längst lebt es nur noch in Welten des Pop…Funke zur Zündung von Körpern, die ihre Umlaufbahnen suchen und wechseln…auf ewig aber verloren sind für »Ludwig vans« und »Sophies Welten«…sich verschwendend in durch und durch weltlicher
Religiosität.
Zwei weitere Stimmen in Rock- und Pop-Music kommen mir in den Sinn, die der Feier der Verschwendung und Verausgabung gleich nahe gekommen sind wie Dylan mit seinem Until we threw it all away. Das sind Lou Reed und die Velvet Underground – mit Nicos Stimme in Sunday Morning – wenn sie, klarwerdend nach dem Sonntag-Morgen-Kater, aufs eigene Leben blicken »With all the wasted years so close behind«; all die verschwendeten Jahre so dicht hinter sich;
uns auf den Fersen, sozusagen.
Und dann Eric Burdon: When I think of all the good times I’ve been wasting having good times. (– was für eine Verschwendung guter Zeit, um gute Zeiten zu haben) Instead of all that drinking/I should have been thinking – – –
Really? Oder »Rilly?« wie Robert Crumb in seine Sprechblasen schreibt. Nein, keine echte Reue. Sinnlose Verschwendung und Verausgabung, für George Bataille Grundkonzepte allen Lebens, sind ausgewandert aus dem ernsten und geschrumpft (oder erweitert) zu Grundkonzepten des Pop. Sie spotten der Verschwendung, sie zeugen vom unversiegbaren Reichtum jener Musiken, die zwar auch (und immer) »Traditionen« etwas schulden, mehr aber (und immer) dem Augenblick. Es ist der jeweilige Moment – Auftrittsmoment, Lebensmoment, geschichtlicher Moment – der, als immer verschwendeter, beim Einzelnen zu Haltbarkeiten und Gewissheiten führt. »Was brauch ich ein Prinzip Hoffnung, wenn ich durch Rock ’n’ Roll Gewissheit habe«, dichtete Wolfgang Neuß, Mensch des genießenden Augenblicks. Er spricht von Gewissheiten, die zu
Haltungen und Konzepten führen, die haltbar und verlässlich sind: bei Dylan schließlich zu einem Konzept wie der Never Ending Tour; kein Ende der Verschwendung; auch kein Ende absehbar neuer Aufbrüche und neuen Landgewinns:
And I was standin’ on the side of the road/Rain fallin’ on my shoes
Heading out for the East Coast/Lord knows I’ve paid some dues/
Gettin’ through/Tangled up in Blue
– so Dylan in diesem Titel aus den vier rätselhaften Worten am Anfang von Blood on the Tracks, 1974, Neustart in Blue nach siebenjähriger Road-Abstinenz. »Gott weiß, ich hab mein Lehrgeld gezahlt«.
Dylans Konzertabstinenz hatte sich ergeben nach der auslaugenden Englandtournee 1966 und seinem anschließenden Motorradunfall; aber nicht nur daraus. Aus der Feststellung That it isn’t he or she or them or it that you belong to hatte sich eine Ausnahme ergeben; und zwar bei der allerüblichsten Ausnahmeposition, bei der Stellung »She«. Bob Dylan heiratet 1965 Sara Lowndes, geschieden, Mutter einer kleinen Tochter und dann Mutter der vier gemeinsamen Kinder, die Sara in den folgenden Jahren gebiert und um die sie sich, es werden Dylans Hausmann-Jahre, gemeinsam kümmern. Auch dies wird verbucht als Verrat in der Scene, eine Abkehr, die kulminiert in einem musikalischen Verrat: der Platte Nashville Skyline, 1970. Dylan kommt hervor aus seinen Family Years mit einer Countryplatte! Mit Johnny Cash, dem
bekannten Redneck-Supporter, als Co-Sänger des ersten Stücks: Girl of the North Country.
Abwegig! (Fand ich damals auch.)
In diesem Band mit Texten zu Bob Dylan gibt es eine (grobe) Chronologie; aber vieles in den ausgewählten Beiträgen überlappt sich zeitlich; ein Hin- und Herspringen zwischen ihnen ist nicht nur möglich, sondern erwünscht. Alle sind so um das Zentrum »Dylan« angeordnet, also montiert, dass jede(r) von einem Stück zum andern, von einer LP zur (über)nächsten, von einem Produktionsabschnitt zu einem anderen, springen kann. Was dies Buch also nicht sein will, ist eine Art Ersatzbiographie. Die ausführlichen biographischen Abläufe und Daten zu Dylan finden sich in Büchern weit größeren Umfangs, den Biographien von Clinton Heylin, Howard Sounes, Paul Williams, Robert Shelton, Anthony Scaduto, Mike Marqusee, Olaf Benzinger und anderen, sowie in den lexikalischen Großversuchen von Michael Gray. Der Schwerpunkt dieser Textsammlung liegt auf Dylans Musik, ihren vielfältigen Stationen und Verästelungen. Zwar kommt auch der Ehe- und Family-Mann vor; auch der Junge vor dem Spiegel, der das rechte Outfit prüft; aber an erster Stelle soll dies ein Buch über den Song & Wordman Dylan sein. Für den Danceman, wie er sich auch genannt hat, waren weniger Belege zu finden.
Es ging, im Pop, von Anfang an ums Ganze. »Niemand«, bemerkt Greil Marcus zum Jahr 1965, »hörte die Musik im Radio als Teil einer separaten Wirklichkeit«. Auch 1956, beim Einbruch von Elvis & Co., war das schon so. Aber 1965 erst recht: »Es schien, als könnte in der Arena des Pop buchstäblich alles passieren, als würde dies auch tatsächlich, Monat für Monat,
der Fall sein. Das Wettrennen fand nicht nur zwischen den Beatles, Bob Dylan, den Rolling Stones und all den Übrigen statt. Die Welt des Pop befand sich in einem Wettrennen mit der Welt an sich, der Welt der Kriege und Wahlen, der Arbeit und der Freizeit, der Reichen und der Armen, der Weißen und der Schwarzen, der Männer und Frauen – und 1965 konnte man
spüren, dass die Welt des Pop im Begriff stand, diesen Wettlauf zu gewinnen«. Das ist großartig gesagt, heillos übertrieben, also unsinnig und doch präzise wahrgenommen. Selbstverständlich wäre es auch nicht »falsch«, zu behaupten, es sei die Rockmusik gewesen, die (neben einigen anderen Unwichtigkeiten) den Eisernen Vorhang zerrissen und die Mauer zum Einsturz gebracht hat.
Pink Floyd, Lou Reed, Bob Dylan
Fighting in the captain’s tower
About who o’ them brought the Wall tumbling down
While Joshua’s planting flowers
Die Imagery von Desolation Row darf auch die Bildhaftigkeit jeder Popschreibe sein; nichts muss richtig sein, aber alles muss stimmen. Popmusik wie Popschreibe leben von einer Logik und einer Power der Momente, der politischen wie der affektiven individuellen. Deshalb ist es möglich, 1964 so gut wie 1974 oder 1988 oder 1997 oder erst 2006 zum Dylan-Fan geworden zu sein; wobei die ältere Sorte nicht unbedingt die fundiertere oder überlegene sein muss. Es geht nie um die Konkurrenz oder die Versammlung von »Meinungen«, die sind so beliebig und meist egal wie in der Polit- und TV-Welt auch. Es geht um den Treffer ins Schwarze, bezogen auf präzise Momente.
So sieht Greil Marcus Dylans Song Like a Rolling Stone nicht bloß als ein brillantes Stück Musik von 1965, sondern als »den bewussten Versuch, in der Welt des Pop zu völlig neuen Ufern aufzubrechen«. In diesem Zuge zu behaupten, nichts in Amerika wäre »wie vorher« gewesen nach diesem Song, und Amerika hätte hier eine unwiederbringliche Chance nicht genutzt, ist so offensichtlicher Unsinn wie dieselbe Behauptung, aufgestellt zur Zerstörung der Twin-Towers: dass nach Ground Zero nichts mehr gewesen sei wie es vorher war; absoluter Quatsch – aber eben doch richtig. Genau richtig. Es kommt auf den Zeitpunkt an, zu dem solches gesagt wird, auf den affektiven Moment und darauf, wer zu wem wie (und wo) spricht.
Denn bekanntlich macht die Geschichte solche Wendepunkte, ob sie nun welche sind oder nicht, grundsätzlich nicht mit. Die Geschichte spielt auf einem anderen Feld, auf anderem Fundament, in einem anderen Basement, und will all so was gar nicht wissen. Die (Pop)-Entscheidung, im (kometenhaften) Erscheinen einer einzelnen bestimmten Single einen epochemachenden Einschnitt zu sehen, kann man verwerfen oder teilen. Widerlegen kann man sie nicht. Pop-Schreibe ist, daneben dass sie sachlich fundiert sein soll, immer parteiisch, eingenommen für ihren Gegenstand, willkürlich in ihren Urteilen, haarsträubend (un)gerecht und doch auf Exaktheit aus; die Exaktheit des Pfeils, der trifft, in die Mitte der Scheibe, und auch ins Herz. Pfeil, der auch verletzt, aber seinen Gegenstand zugleich für unverletzlich erklärt; unter der unmöglichen Parole: »Dingsbums for ever«.
In diesem Fall ist’s Bob D., der die Position »unverletzlich verletzlich« einnimmt; ihm wie den Lesern, Fans & Feinden, soll’s nicht schaden. Nein, nicht nur nicht schaden; die Textauswahl, getroffen nach der Pointiertheit der einzelnen Stimmen, möge gefallen. Frommer Wunsch; als solcher unerfüllbar; außer in der Welt von Bobby-Gods. Dass Amerikaner nicht »an
Gott glauben«, sondern an ihre eigene Göttlichkeit, habe ich an anderer Stelle vermerkt. In dieser Hinsicht ist Bob D. ein echter Amerikaner. Keiner von ihnen steht das harte Erwerbs-, Konkurrenz-, Kriegs- und Liebesleben durch ohne die Auszeit einer Neu- oder Wiedergeburt.
Bob Dylan nahm seine zwischen 1978 und 1981 und hat sich gut davon erholt. Seit den 90ern folgt eine gute Platte der andern.
See you …
(Vorwort. Klaus Theweleit, Das Bob Dylan Lesebuch, 2011)
***
Truffaut & Godard – Deux de la vague
Ein Film von Emmanuel Laurent, FR 2010
& Emilie Bickertons Buch Eine kurze Geschichte der Cahiers du Cinéma, London, 2009,dt. bei diaphanes, Zürich 2010
(publiziert in SPEX, Mai/Juni2011)
Zwei von der Welle also. Hätten die Macher noch ein »s« drangehängt, wären es Zwei von den Wellen geworden…oder auch Zwei auf den Wellen…mit den Wellen…eins so schön wie das andere…immer aber eher Lichtwellen anpeilend als Donauwellen oder Meereswogen; oder auch die Sättel über Prairie-Wellen: John Fords Two Rode Together war jederzeit anwesend im frühen Filmen & Leben von François Truffaut und Jean-Luc Godard…der Colt lag ihrer Schreibmaschine und auch ihrer Kamera näher als »gesetzte Segel auf den Ozeanen«…auch wenn Quatre Cent Coup (Sie küssten und sie schlugen ihn) mit Meerbildern endet…mit den fliehenden Füßen von Antoine Doinel/Jean-Pierre Léaud am Strand…& das Publikum von Cannes 1959 zu den Buchstaben FIN in rauschenden Beifall ausbricht.
Der Durchbruch war geschafft…der Colt der Schreibmaschinen, unablässig feuernd in den Cahiers du Cinéma und in L’Art im Kampf für das gute wahre Kinoschöne…für Hawks und Hitchcock…für Jean Renoir und Rossellini…gegen das Böse des etablierten französischen Kino-(Un)Wesens, das den Film in Studios sperrte… Staatsgelder abzockte…das Kino nicht unterschied von Roman und Theater…nun endlich ersetzt durch die Kamera in der eigenen (amerikanisierten) Hand. Godards About de Souffle ist Baby Doll gewidmet und Rio Bravo. Den Stoff für den Film – die Geschichte des jungen Kriminellen Michel Portail, der einen Polizisten erschoß und sein Leben endete nach High Life mit einer amerikanischen Journalistin in Paris – bekam Godard geschenkt von Truffaut (der hatte alle Artikel gesammelt). Stoff aus der Zeitung und aus dem laufenden Leben; immer das Kino anderer vor Augen; so wie Belmondo blickt in Außer Atem ins Gesicht von Humphrey Bogart oder, in Une femme est une femme, in das von Burt Lancaster aus Robert Aldrichs Vera Cruz…»großer Bruder Burt«.
Die Zwei von der Welle starten in Blickverschlingung mit einigen Heroen Hollywoods. Emilie Bickerton in der Einleitung zu ihrem Buch Eine kurze Geschichte der Cahiers du Cinéma zitiert Godard: »Wir hatten in dem Moment gewonnen, als akzeptiert wurde, dass ein Film von Hitchcock ebenso bedeutsam ist wie ein Buch von Aragon. Durch uns haben die Autorenfilmer Eingang in die Geschichte der Kunst gefunden«. Bei Bickerton erscheinen die Zwei von der Welle erweitert zu einer (im Kern) fünfköpfigen Band – nicht: Gang – obwohl unter ihnen im Verlauf der 60er Redaktionskriege ausbrechen werden: Jacques Rivettes Schlagzeug vertrug sich nicht mit den Basslinien Eric Rohmers; Chabrols Gesang passte nicht mehr; und Truffaut und Godard hatten die Schreibclique verlassen und bliesen ihr Horn hinter der Kamera.
Laurents Film beginnt mit Godards Stimme aus dem Off: »Jetzt, wo François tot ist, beschützt er euch nicht mehr«, habe Anne-Marie Mieville, Godards Frau, zu ihm gesagt. Um (gegenseitigen) Schutz (mit und ohne Colt) und um inspiriertes Zusammenspiel ging es am Anfang in der Tat. Mit diesem »uns« sind sie alle gemeint: die ganze Nouvelle Vague und ihr Umkreis. Nach Truffauts Tod 1984 fanden sie sich, nun jeweils allein, in hoffnungsloser Unterlegenheit gegenüber dem laufenden Kino (nun fest in der Hand von schlechtem Hollywood). Eine machtvolle Einheit waren sie nur mit Truffaut; mit Truffauts »schützender Hand«; schützend, weil sie alle Sorten Kino verband und nur Truffaut »bei allen« akzeptiert war. Godards Gesicht sehen wir nicht. Die ersten Bilder von Laurents Film gehören ganz Truffaut und Quatre Cent Coups, gehören dem 14-jährigen Jean-Pierre Léaud.
Sie gehören auch André Malraux, Kultusminister der Regierung de Gaulle, der den Film als offiziellen Beitrag Frankreichs für Cannes befürwortet hatte: der Kopf des »feindlichen Lagers« selber hatte sich ergeben. Was für ein Triumph! 1958 noch war Truffaut wegen seiner Angriffe aufs aktuelle französische Kino die Akkreditierung für Cannes verweigert worden. Der Apparat schlug auch bald zurück: schon Godards zweiter Film Le Petit Soldat wurde von der Zensur (=Malraux) verboten, weil er französische Folter zeigt im Kontext des Algerienkriegs.
All diese Dinge bringt der Anfang von Deux de la vague ins Spiel; vielversprechend. Wir erfahren von Godard, dass er selber – auf seine Weise – mitgewirkt hatte an dem Verbot. Ihm war der Erfolg von About de Souffle unheimlich. »Mein nächster Film wird hoffentlich ein Flop«, wünschte er sich; und das war’s, was er bekam. Film Nr. 3 und Nr. 4 floppten dann ebenso, am schlimmsten Les Carabiniers, den nur 20.000 Pariser sehen wollten. Und das war nun nicht mehr »gewünscht«. Godard mußte erkennen, dass »die Franzosen«, in der (falschen) Sonne des »Siegers« von WK II und aktuell involviert in Algerien und Indochina absolut keinen Film wollten, der den Krieg als Krankheit zeigt und den Krieger als lächerliche Figur. Godard: »In meinem Film sieht man, dass die Dummheit des Kriegs von der Dummheit der Menschen kommt. Sowas will niemand sehen«. Erst mit Vivre sa vie (Die Geschichte der Nana S.) und einer unwiderstehlichen Anna Karina kam der Erfolg, nun via Weltruhm, zurück. Auch Truffauts zweiter Film, Schießen Sie auf den Pianisten, floppte.
Deux de la Vague verfährt im Wesentlichen chronologisch: Vorgeschichte der beiden bei den Cahiers, Vorgeschichte von About de Souffle etc. Wir sehen dazu, und da wird es mulmig, das Bild einer jungen Frau, die in einem Stapel der gelben Cahiers blättert; nachdenkliches Gesicht, dazu eine Sprecherstimme mit Zitaten aus den Heften. Wir hören von dem Brief, in dem Truffaut sich bei Beauregard, dem Produzenten von Außer Atem, für Godard als Regisseur verwendet; und der ebenfalls brieflichen Bürgschaft für das Drehbuch, die Chabrol abgibt. Im Bild dazu: eine alte Schreibmaschine, tippende Finger und das eingespannte Blatt Papier, auf dem nun die damaligen Zeilen Truffauts an Beauregard sichtbar werden. In der Tat war es die Solidarität der Schreibkollegen, die Godards Filmstart ermöglichte. Aber wozu diese Sorte Nachinszenierungen (wie sie mittlerweile so gut wie jede TV-Doku belasten wenn nicht verderben). Wer hat sich den Scheiß bloß ausgedacht: Als ob wir Truffauts Post an Beauregard erst glauben, wenn wir sehen (zu Schreibmaschinengeräusch), wie ein unsichtbarer Jemand französische Wörter auf ein weißes Blatt Papier hackt? Und daß das Zitat aus den Cahiers wahrscheinlich stimmt, wenn ein hübsches Frauengesicht im Bild in einer Cahiers-Nummer blättert? Der Name der jungen Frau erscheint im Vorspann als der einer Hauptdarstellerin; eine Pest, grassierender Rindenwahn in zeitgenössischen Dokumentaristenhirnen (Diktat von Fernsehredaktionen?)
Deux de la Vague wird dadurch nicht verdorben, aber beeinträchtigt; völlig unnötig, bei der Fülle guten Materials: allein schon der Ausschnitte aus Filmen der beiden, einschließlich ihrer frühen Kurzfilme; dazu das reichliche Interviewmaterial und Bilder von ihren gemeinsamen öffentlichen Auftritten; sei es von der Sprengung des Cannes-Festivals 1968, seien es Bilder von den Aktionen für Henri Langlois, Direktor der Cinemathèque Francaise, Aktionen gegen deren angekündigte Schließung. Die Einleitung des Pariser Mai 1968 kommt in der Tat aus dieser Filmer-Szenerie.
Gemeinsame Arbeit an Kurzfilmen: Truffaut, der Schnellfilmer, dreht Szenen mit Schauspielern während eines Hochwassers vor Paris; weiß dann aber nicht recht, was damit anfangen. Er zeigt das Material Godard, der schneidet es anders und erfindet Dialoge für die Schauspieler. Geschichte vom Wasser entsteht daraus, eine Reflexion übers Leben und seine Einbrüche; eine tatsächliche Co-Produktion, wie beim Schreiben vieler Artikel in den Cahiers; Truffaut ist dort seit 1951, Godard 1952. Erste Berührung: 1949 in einem Filmclub (betrieben von Rohmer). Auch Rivette und Chabrol starten mit Kurzfilmen. Godard hat später oft betont, wie wichtig der Charakter als Gruppe war, dem sie alle, mehr oder weniger, ihre spätere Existenz als Film-Autoren verdankten. Man kommt nicht alleine auf das Neue. Das Sehen, das Schreiben darüber, das Filmdenken und dann das Filmemachen sind nur graduell Sache von Einzelnen; die Neu-Findungen kommen aus einem Gruppenkörper in einem bestimmten Zeitmoment; einem Gruppenauge, Gruppenhirn, das allerdings einen Manifestationsort braucht: zuerst die Cahiers (Truffaut liefert eine angemessene Würdigung ihres Gründers André Bazin) und dann die Leinwände der Welt. Insofern ist es natürlich willkürlich, Truffaut/Godard aus dem vielköpfigen Gruppenkörper herauszuheben. Eine Dokumentation über die Big Five – die zu erweitern wären durch Jacques Demy/Agnes Varda, Jean-Pierre Melville und Louis Malle zur (mindestens) neunköpfigen Herakles-Hydra, die dem »Kino der Väter« das Haupt abbiß – wäre angemessener (aber schon wieder ein 9-Stunden-Film).
Deux de la Vague dokumentiert das Aufsuchen der richtigen Väter. Truffaut macht Assistenz bei Rossellini (Rossellini und Bazin sind seine Trauzeugen, schon 1957); dann, zusammen mit Chabrol die ersten Interview-Besuche bei Hitchcock. Godard zitiert nicht nur in den Filmen, sondern auch vor der Kamera: »“Zu jeder wahren Moral gehört der Widerstand gegen Tyrannei“ – Orson Welles, dem das moderne Kino alles verdankt«. Und er interviewt, bewundernd, Fritz Lang: Der Dinosaurier und das Baby; Lang bedankt sich mit seinem Auftritt als »Regisseur Fritz Lang, der die Odyssee verfilmt« in Godards Le Mépris (Die Verachtung).
Selten – egal auf welchem Gebiet – hat man Künstler in solch enthusiastischer Verehrung von Vor-Vätern ihre eigene Arbeit starten sehen. Truffaut: »Hitchcock würde auch als stummer Filmer funktionieren«. Fritz Lang: »Film ist nicht nur die Kunst des Jahrhunderts, er ist auch die Kunst der Jugend«. Godard: »Gegenüber dem Film sind alle andern Künste etwas außer Atem« (lächelt). Truffaut lobt Rossellinis »technikloses Denken; er macht einfach das Richtige«. Godard: »Er scheitert auch oft; wechselt aber immer die Richtung; wie Orson Welles« (und, soll man hören, wie Godard selbst). Einstimmig beide über Jean Renoir: »Der Regisseur, der nie irrte…findet immer menschliche Lösungen…hat nie einen Stil gesucht«. Desgleichen Ingmar Bergman, Auflöser von Regeln. Überhaupt, die Regeln. Wie man schneiden müsse, wie man Fahrten zu machen habe, alles, was man (angeblich) »so oder so macht«: alles Quatsch. Zwei auf einer Welle.
Die Verehrung überträgt sich auf die eigenen Arbeiten: 1964 co-produziert Truffaut Godards Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß; und schreibt einen Artikel: Zwei oder drei Dinge, die ich von ihm weiß. »Godard ist nicht der einzige, der filmt wie er atmet. Aber er atmet am besten. Er ist schnell wie Rossellini, listig wie Sacha Guitry, musikalisch wie Orson Welles, einfach wie Marcel Pagnol, verletzt wie Nicholas Ray, effektiv wie Alfred Hitchcock, profund wie Bergman und frech wie kein anderer. Es gibt das Kino vor Godard und das Kino nach Godard«.[1] Zum Vorwurf, Godard würde überall klauen (=zitieren) sagt Macha Meril, sein Star in Eine verheiratete Frau, »Ja, er klaut. Er klaut von der Realität«. Weder Truffaut noch Godard noch sonst einer der Autorenfilmer Mitte der 60er bezweifeln, dass es eine größere Nähe zur »Realität« geben könne als beim Filmemachen (=Atmen.)
Der letzte Teil von Deux de la Vague gilt dann dem Zerwürfnis von Godard und Truffaut; begonnen in einer weiteren Gemeinsamkeit, ihren jeweiligen Arbeiten mit Jean-Pierre Léaud. Léaud als Antoine Doinel aus Le Quatre Cent Coup, aus Tisch und Bett etc. ist Truffauts Geschöpf, ganz und gar. Als Godard ihn sich ausleiht für Masculin/Feminin betritt Léaud keine andere, aber für ihn neue Welt als Kino-Figur. Godard habe ihn von Antoine Doinel befreit, wird er später sagen. Was nicht heißt, er habe diese Figur verlassen. Mehrere Filme als Antoine Doinel bei Truffaut sind ja gefolgt. Aber eine Art Ideal-Konkurrenz war aufgemacht. Jean-Pierre Léaud bei Godard ist dem Léaud bei Truffaut zumindest an Rasanz und Ausgeflipptheit überlegen; und ein Stück weiter in radikalpolitischen Szenerien, wie in La Chinoise und in Weekend. Léaud selbst formuliert, er habe ab da zwei Väter gehabt, einer ihm so lieb wie der andere. Und beider Sohn ist er geblieben, ohne Bruch.
Aber zwischen Truffaut und Godard bahnt ein Bruch im Politischen sich an. Im Pariser Mai und bei ihrer Forderung nach Abbruch des Cannes-Festivals 1968 in Solidarität mit den streikenden Arbeitern und Studenten sind sie sich noch einig. Godard beschimpft Regisseurskollegen, die »nur an Einstellungen denken« und trotz Polizeigewalt weiter festivalieren wollen (unter ihnen Roman Polanski) als »Arschlöcher«. Und Truffaut stimmt zu.
Als Godard kurz darauf aber sein Spielfilmwerk abbricht (von später her muß man sagen: unterbricht) und mit seiner Gruppe Ciné-Prawda sog. Ciné-Tracts zu filmen beginnt: Agitationsfilme zur Unterstützung der Arbeiter und Studenten in ihrem Kampf gegen das kapitalistische System, ist Truffaut nicht mehr dabei. »Kunst, die sich einer Politik unterwirft, hört auf, Kunst zu sein«, ist seine Antwort an Godard. Als Beispiel nennt er Matisse, vor, zwischen und nach den Kriegen.
Der Bruch wird dramatisch offen am nächsten Film Truffauts mit Jean-Pierre Léaud: La Nuit Américaine, Film von der »Innenseite« des Filmgeschäfts, wie Godard ihn ein Jahrzehnt zuvor mit Le Mépris gemacht hat in der Tradition entsprechender Hollywoodfilme von Robert Aldrich oder Vincente Minelli, The Legend of Lylah Claire, Stadt der Illusionen oder Two Weeks in Another Town, die sie gemeinsam bewundert hatten. Godard findet Truffauts neuen Anlauf auf diesen Themenkomplex überholt, geschönt und komplett verlogen. Einen Brief an Léaud, den Truffaut ihm aushändigen möge, legt Godard seinem Schreiben an Truffaut bei. Truffaut händigt nicht aus; er schickt den Brief an Godard zurück mit einer eigenen 20-seitigen Antwort, seinerseits voller Vorwürfe: Godard habe immer das Opfer gespielt und dabei doch alles erreicht; und ein Lügner in vielen Punkten sei er selber. Die tatsächliche Schärfe der schließlich gegenseitigen Vorwürfe gibt Laurents Film nicht wieder (man kann diese Korrespondenz nachlesen in der Ausgabe der Briefe Truffauts). Es hätte für Laurent bedeutet, seine beiden Helden, die Ritter von der Welle, am Ende zu ruinieren und den Titel des Films zu dementieren: Jeder auf seiner Welle, allein, wäre übrig geblieben. Das hat Emmanuel Laurent nicht gewollt; und ist auch okay so. Das Two Rode Together hatte immerhin 20 Jahre gehalten und das ist mehr als bei den meisten vergleichbaren Produktionspaaren in der Kunstwelt.
Ein paar Bilder vom alternden Léaud als Letztem Mohikaner komplettieren den Komplex. Schließlich hat auch Godard ab Ende der 70er wieder Spielfilme gedreht und tut es bis heute. Daß Godard zur Ausgabe der Briefe Truffauts (mit der für ihn wenig schmeichelhaften Erwiderung Truffauts auf seine Attacke) ein Vorwort geschrieben hat, sehr versöhnlich und freundschaftlich, hätte Laurent allerdings erwähnen können. Es muß aber wohl (immer?) erst ein Tod eintreten oder dazwischentreten, um das Leben und die Arbeit langjähriger Mitstreiter angemessen zu würdigen. So lange sie am Leben sind, ätzt das Gift der Verletzungen à deux doch zu stark.
Heute besteht eher der Satz, das Truffaut fehle; dass der Schutz fehle, den er bot gegenüber »dem Apparat« und der Medienöffentlichkeit, seine Funktion als Klammer über der Gruppe. Zwar haben Rivette, Rohmer, Chabrol und Godard weitergemacht, Rohmer und Chabrol sogar mit beachtlicher Publikumsresonanz, aber das Gefühl, sie würden in eine Richtung arbeiten, war weg. In Interviews mokier(t)en sie sich eher übereinander. Und gemeinsam Essen in Pariser Restaurants hat man sie auch nicht mehr gesehen. Nun sind als die zwei letzten der magischen Gruppe übrig Godard und Rivette. Chabrol und Rohmer brachten es auf 50 Jahre ununterbrochener Produktion, Godard und Rivette reiten die Welle nun schon über ein halbes Jahrhundert. So did Hitchcock; und Fritz Lang beinahe fünfzig, wie Jean Renoir. Die Stones und Bob Dylan erreichen die 50er-Marke dieses Jahr. Jungsein ist nur bedingt eine Frage des Alters. Eins sind die letzten Filme Godards gewiß nicht: altersweise. Er plagt sich weiterhin mit der Frage: Was ist ein Bild. Sowas hält frisch; so wie Bob Dylan weiterwerkelt an der Frage: Was ist amerikanische Musik – und darf nun erstmals in China auftreten (Sonderzug nach Peking).
Emilie Bickertons Buch Eine kurze Geschichte der Cahiers du Cinéma, erschienen 2009 in London, und nun, rechtzeitig zum 60. Geburtstag der Cahiers auf deutsch bei diaphanes in Zürich, rückt solchen Fragen kaum auf die Pelle. Die Geschichte der Cahiers ist zu datenreich, um viel Platz für theoretische Exkursionen zu lassen. Die Verdienste des Buchs der englischen Filmkritikerin von der New Left Review liegen in der Geschichtsdarstellung, wobei 80 Seiten, knapp die Hälfte des Buchs, den »gelben Heften«, der Basis ihres Ruhms, gelten. Gegründet 1951 bringt es die Zeitschrift unter der Chefredaktion von André Bazin, der theoretische Klarheit mit der außerordentlichen Gabe einer breiten Personenakzeptanz verband, auf 10.000 Abonnenten bis Ende der Sechziger; im Bewusstsein aller Beteiligten, dass ästhetische Fragen, ob »hohe« Kultur«, ob Popkultur, zeitgemäß nur im Rahmen Kino abzuhandeln sind: »Über Populärkultur in einem gehobenen Duktus zu schreiben, ohne von vornherein über ein legitimierendes Programm zu verfügen« (Bickerton), ist zum Gründungselement aller späteren Popschreibe mit Anspruch geworden; auch Musikmagazine wie die Spex gründen selbstverständlich im Denken und in der Machart der Cahiers (ab 1964 in wechselnden Farben, »bunte Jahre«; ab 1969: in Rot). Nicht zu Unrecht nennt Bickerton die Cahiers »das letzte Projekt der Moderne«. Unter den Abonnenten sind 400 amerikanische Universitäten: die gelben Hefte werden so auch zur Grundlage dessen, was heute, institutionalisiert Filmstudies in den USA heißt. Und, weil amerikanische Film-Addicts, meist Frauen, dafür Französisch lernen mussten, wurden die Cahiers gleichzeitig zum Eingangstor der Schriften von Jacques Lacan ins amerikanische (Kino)Denken.
Bickertons Blick ins Innenleben der Cahiers zeigt allerdings, dass die anfängliche Gruppenübereinstimmung, die kampflustige Schreibe der sog. »Jungtürken« – das ist die Gruppe um Truffaut und Godard – die zu einem gemeinsamen Sound der gelben Hefte, zu einer band-artigen Theorieproduktion geführt hatte, schon Anfang der 60er weitgehend zerfallen war. Erstaunt nimmt man zur Kenntnis, dass insbesondere zur Filmarbeit der Regisseure der Nouvelle Vague bei Bickerton wenig zu erfahren ist. Das liegt daran, dass die Redakteure der Cahiers über die Filmarbeiten der Kollegen zunächst sehr wenig schrieben und dazu überwiegend negativ (Verriss etwa von Außer Atem); vordergründig begründet damit, dass man nicht simpel »pro domo« schreiben wolle, also die eigenen Kumpels in den Himmel heben. Dahinter: Konkurrenz und dann auch Missgunst (getarnt hinter der ideologischen Maske von »Linienkämpfen«). Die erste große Revolte gibt es 1963: die Ablösung Eric Rohmers als Chefredakteur durch Jacques Rivette, von Bickerton als Putsch bezeichnet. Nach der Nr. 144 wird Rohmer auf die Straße gesetzt.
»Am Anfang von Rivettes Herausgeberschaft zwischen 1963 und 1965 stand eine große Empfänglichkeit gegenüber anderen Disziplinen und intellektuellen Strömungen wie Anthropologie, Literaturtheorie und etwas später die Lacan’sche Psychoanalyse sowie von Althusser entwickelte Konzepte des Ideologischen«; auch Roland Barthes und Claude Levi-Strauss werden genannt; Ausstellungen von Jackson Pollock und Mark Rothko, mit denen die Cahiers sich befassen, Pierre Boulez, Arnold Schönberg, Webern und Alban Berg; überhaupt: die Musiker. 1964 widmet Rivette eine Ausgabe allein der Musik/Filmmusik. Es entsteht eine Art Gesamtschau der Künste rund herum um den Film als der Kunst des 20. Jahrhunderts.
Spätestens hier erinnert mich einiges an das deutsche Pendant zu den Cahiers, an die Münchner Zeitschrift Filmkritik unter Enno Patalas und Frieda Grafe. Über die Filmkritik und Frieda Grafe schreibend, habe ich früher angemerkt, dass viele der französischen Theorienamen mir im Deutschen zuerst in der Filmkritik begegnet sind, besonders oft in den Texten Frieda Grafes. Dieser Befund lässt sich erweitern. Eine ganze Reihe von scharfen Auseinandersetzungen, die auch die deutsche Diskussion prägten, sind in den Cahiers präfiguriert: die Verwerfung von René Clements Nur die Sonne war Zeuge als eine Art Fake-Nouvelle-Vague-Film. Die Verwerfung von Costa Gavras Polit-Film »Z« als pseudolinke »Schweinerei«, der Wutausbruch über Claude Lelouchs Ein Mann und Frau (= Rückeroberung des Cannes-Festivals durch das Mainstreamkino). Dies und Vieles mehr, das bei Bickerton als spezifisch französisch Umkämpftes erscheint, war mir beim Lesen geläufig aus seiner damaligen deutschen Spielart – weiterer Beleg für stupenden Verästelungen der Wirkungsweise der Cahiers.
Auch der Radikalbruch in Konzeption und Aufmachung der Hefte am Anfang der 70er hat seine deutschen Parallelen, kurz gesagt in dem, was hier als K-Gruppen-Politik bekannt bzw. berüchtigt ist. Bickerton zitiert Truffauts Worte seiner Trennung von den Cahiers: »Es ist keine Meinungsverschiedenheit. Es liegt einfach daran, dass mein Name in der Zeitschrift für nichts mehr stand. In den Jahren, in denen ich für die Cahiers arbeitete, war das ganz anders. Wir diskutierten Filme auf rein ästhetischer Grundlage. Heutzutage geben sich die Cahiers unverhohlen politisch. Redakteure produzieren marxistisch-leninistische Interpretationen von Filmen. Niemand außer Akademikern kann die Zeitschrift noch lesen. Was mich betrifft, so habe ich nie eine Zeile von Marx gelesen. Aber sie machen gute Arbeit und tragen substantielle Berichte zusammen. Ihre Publikation von Eisensteins Texten ist exzellent«.
Diese Theorielinie immerhin bleibt. Die Cahiers der 70er publizieren eine Reihe von Grundlagentexten zur Filmtheorie; aber keine Filmbilder mehr, keine Filmdiskussionen. Die Zeitschrift verliert über 10.000 Käufer, macht aber immerhin nicht dicht (was deutsche K-Genossen unverzüglich vorgenommen hätten). Es dauert bis in die 80er, bis, nach diversen Verlegerwechseln, der Filmkritiker Serge Daney, ein Mann eher auf der frühen Kulanz-Linie von André Bazin, die Chefredaktion übernimmt; ohne allerdings die glanzvolle Ausstrahlung der gelben und der bunten Jahre wieder zu erreichen. Das Kino hat seine »zentrale Position« verloren. Und die Cahiers ihre Exklusivität; ein »Niedergang«, den Bickerton konstatiert: die Cahiers in Hochglanz als ein »weiteres banales Sprachrohr des Spektakels«, belangloses Anhängsel des Oscar-Getues, »kaum anregender als die Bordlektüre im Flieger zum nächsten Festival«; in ihren Augen bloß »eine Art besserer Viehmarkt«.
Jede Menge aufgeworfener Fragen also bei der Bickerton-Lektüre zur möglichen oder wünschenswerten Struktur heutiger Pop-Magazine.
[1] Ich gebe hier die dt. Untertitel wieder. Beim Hören scheint mir, hier und da könnte man anders übersetzen.
Zu den Kunstverfahren der Filme von Claude Lanzmann
(publiziert im Beiheft zur Gesamtausgabe der Filme von Claude Lanzmann bei absolut medien, 2010; der Abschnitt über »Der Karski-Report« auch in SPEX # 329 Nov/Dez 2010)
Unvermeidlich landet Claude Lanzmann, nach seinen publizistischen Werdegängen befragt, bei Fragen des Medialen:
»Ich habe die Geschichte Israels anfangs kaum verfolgt. Als Israel im Mai 1948 gegründet wurde, war ich gerade in Westberlin. Es war die Zeit der Luftbrücke, und ich interessierte mich für alles außer für Israel. Ich bin damals heimlich in die DDR eingereist – die Russen wollten mir kein Visum geben, da ich als Journalist für die ‚kapitalistische Presse’ arbeitete – und habe eine Artikelserie geschrieben, die unter dem Titel „Deutschland hinter dem Eisernen Vorhang“ in der Zeitung Le Monde veröffentlicht wurde. Danach habe ich mich entschieden, eine ähnliche Serie über Israel zu schreiben. Meine erste Reise nach Israel 1952 war aber ein Schock für mich. Dort habe ich entdeckt, dass es sehr wohl eine jüdische Identität gibt, dass das jüdische Volk und die jüdische Kultur seit Jahrtausenden existieren und dass Sartre sich geirrt hatte: Die Juden wurden nicht erst durch den Antisemitismus erschaffen! All das warf sehr persönliche Fragen auf, und mir wurde klar, dass es obszön wäre, meine intimen Gedanken in die Spalten einer Zeitung zu zwängen. Ich konnte die Reportage nicht schreiben. Nach vier Monaten bin ich zurück nach Frankreich gereist und habe mich mit Sartre und Simone de Beauvoir getroffen, um über dieses Problem zu sprechen. Sartre schlug vor, dass ich ein Buch schreiben solle. Ich habe ungefähr hundert Seiten verfasst, die nicht schlecht waren, aber danach habe ich das Schreiben abgebrochen. Die Fragen, die mich bewegten, konnte ich auch auf diese Weise nicht beantworten – ich war noch zu jung, ich musste noch wachsen. Zwanzig Jahre nach der nicht geschriebenen Reportage und dem abgebrochenen Buch entstand dann mein erster Film. Ich konnte ihn ziemlich schnell drehen, denn ich wusste endlich, was ich zeigen wollte. Er heißt „Warum Israel“, weil er das Land aus der Sicht eines Juden aus der Diaspora zeigt, der die Normalität, die Israel anstrebt, als anormal erkennt«.
Das heißt, zunächst einmal ganz schlicht: in dem Moment, wo Lanzmann weiß, was er wirklich machen will, da ist er 45, ist er gelandet beim Medium Film. Es folgt »ein jahrelanges unbestimmtes Vortasten entlang der Lektüre von Raul Hilbergs monumentaler Studie und der Akten des Frankfurter Treblinka-Prozesses; Gespräche mit Historikern und Zeitzeugen, Recherchen in den USA, Israel, Deutschland; schließlich die evidenzhafte Einsicht, dass der Film genau das zum Thema haben müsse, wovon es der Natur der Sache nach keine medialen Aufzeichnungen und keine direkten Zeugenberichte geben konnte: den Tod in den Gaskammern«.
Simone de Beauvoir, die zu den ersten Menschen gehörte, die 1985 den fertigen Film Shoah sahen, sah ihn sofort nicht als die Arbeit eines Dokumentaristen. Die vielen »Wiederholungen« des Films, Resultat der übereinstimmenden Beschreibungen der Taten der Judenmörder, erschienen ihr als artistische Mittel, wie Wiederholungen eines musikalischen Themas, als Leitmotive; der ganze Film erschien ihr als eine »musikalische Komposition« oder auch »poetische Konstruktion« – »wenn diese Bezeichnung bei einem solchen Gegenstand erlaubt ist«. So hörte sie die Permanenz der unerträglichen Geräusche der Dampflokomotiven und Züge der deutschen Reichsbahn auf der Tonspur von Shoah auch als »Rhythmisierung« des Films.
Die Frage nach den filmischen Mitteln, mit denen Lanzmann die historische Exaktheit und die unerhörte Eindringlichkeit seiner Filme erreicht, stellt sich so als die zentrale Frage auch für heutige Zuschauer beim Ansehen dieses »wahren Meisterwerks« (de Beauvoir): »Eine solche Verbindung von Grauen und Schönheit hätte ich nie für möglich gehalten«. Grauen & Schönheit – Kunst.
Wie wichtig die Betonung der eigenen Arbeit als Kunstarbeit für Lanzmann immer war und ist, ergibt sich im Jahr 2009 aus seiner Antwort auf die Frage, was er vom Verfahren der Spielberg Foundation halte, Überlebende der Shoah vor Kameras ihr Leben erzählen zu lassen. Lanzmann:
»Ich drehe Kinofilme, und diese Filme haben nichts mit dem zu tun, was Spielberg da treibt und was sich „oral history“ nennt. (…) Wenn Steven Spielberg die Leute auf Video über ihr Leben Auskunft geben lässt, dann ist das vielleicht gut für die Familien, die ihre Angehörigen in Erinnerung behalten wollen. Alles was darüber hinausgeht, braucht jedoch eine künstlerische Form. Spielberg sammelt nur persönliche Geschichten, die aber keinen größeren Sinn ergeben. Seine Shoah Foundation hat noch dazu einen furchtbaren Kinofilm gemacht: The Last Days. Darin werden die Erzählungen zerschnitten und mit Musik unterlegt. Das ist ein Albtraum«.
Seine eigene spezifische Kunstarbeit sieht Lanzmann als Vermeidung solchen Albtraums. So wird es zur ersten Aufgabe heutigen Schreibens über Lanzmanns Filme, deren spezifischen Kunstcharakter zu erörtern.
Lanzmanns Shoah ist nicht nur durchzogen, er ist strukturiert von der Bewegung von Fahrzeugen, vor allem der fahrenden Lokomotiven und Züge in einem reduzierten Tempo, das nicht einfach eine ’Geschwindigkeit’ ist. Die Züge transportieren uns, unseren Blick, in die Landschaften, die wir nicht kennen, an die Orte, die wir nicht kennen, wir werden langsam herangefahren an die Rampe von Auschwitz, an die Stelle, wo der Bahnhof von Treblinka war, der Bahnhof von Sobibor. Lanzmann setzt die originalen Zugmaschinen ein, er spricht mit jenen Lokführern, die noch am Leben sind, aber all dies nicht nur, um ins Bild zu setzen, welche entscheidende Rolle die Deutsche Reichsbahn gespielt hat bei der tatsächlichen Durchführung der Vernichtung. Es ist mehr, wozu Lanzmann die fahrenden Züge benutzt; sie werden zu einer Art Zeitmaschinen, sie ziehen uns hinein in die 1940er Jahre, hinein in die östlichen Ebenen, durch Nebel, über Schneefelder, Wälder. Mal sind sie selbst im Bild in ihrer langsamen, näherziehenden Bewegung, mal transportieren sie die Kamera und damit unseren schwebenden Blick näher an die Schauplätze heran, wir nähern uns, selbst auf den Zug gebunden, an die Bewegung des Zuges gekettet, den Schauplätzen der Vernichtung, das schreckliche Geräusch der schnaubenden Lokomotiven im Ohr, sie befördern uns tatsächlich ins Jenseits – ins Jenseits unserer Körper, unseres Wissens; ins Jenseits unserer Geschichte, von der wir so wenig wissen und wissen wollen; und ins Jenseits der Toten, in das wir gezwungen werden einzufahren und das in Gestalt der Lokomotiv-Ungeheuer auch in uns einfährt. Im Innern dieser Monster selber Verbrennungsöfen, die ihren Rauch und Dampf um sich speien.
Das einzige Verkehrsmittel, das technisch in der Lage war, die Massentransporte der Juden zu den Vernichtungslagern logistisch zu bewältigen, wird so in Lanzmanns Shoah sowohl dargestellt wie auch umfunktioniert zum Vehikel, das uns hineintransportiert in die tatsächliche Geschichte des Mords an den Juden…eine Erinnerungsmaschine, auf der wir, festgeschnallt, den Kohlenstaub und den Fahrtwind des ’leeren Ostens’ in den tränenden Augen, uns langsam, aber stetig auf die Hadestore zubewegen, die dabei sind, sich zu öffnen: fast alle Menschen, die wir im Film sprechen hören, waren jenseits dieser Tore; jeder von ihnen sollte tot sein, eigentlich; sie sind unerwartet Übriggebliebene…zurückgekommen von dort, von wo niemand zurückkommt.
»Die Gaswagen sind hier reingekommen, da, hier waren zwei große Öfen, und nachher haben die hier die reingeschmissen, in die, in den Ofen, und das Feuer ist gegangen zum Himmel«. Simon Srebnik steht auf einer großen Wiese, als er das erzählt. Tief, tief im Osten, Wald drumrum, die Vögel singen, sonst ist es still. Es ist still, als wäre hier nie ein Mensch gegangen. Kein Gebäude, kein Acker, keine Spur. Lanzmanns Kamera ist langsam herangefahren an diesen Ort, die Kamera auf einen Wagen montiert, der das Tempo der Saurer-Lastwagen mit den Ermordeten nach-fährt. Wir beginnen zu sehen mit den Augen der Täter wie mit den Augen der Toten, die dies nicht mehr sehen konnten, aber sie sind hier; jeder Grashalm ist wie für ein Auge. Und müssen denken: Es gibt überhaupt keine Stille auf der Welt, kein Stückchen Erde, gerade die ’friedlichsten’ nicht, gerade sie sind das Massengrab, schwarze Löcher der ’Stille’ mit Vogelschreien. Vierhunderttausend Juden sind auf diesen Lastwagen umgebracht worden.
Shoah, sagt Lanzmann, ist »ein Film über den Tod, nicht über das Überleben. Es gibt darin keinen einzigen Überlebenden, es gibt allenfalls Wiedergänger, die fast schon im Jenseits über dem Boden des Krematoriums schwebten und zurückgekommen sind. Diese Menschen sagen niemals „ich“, sie erzählen nicht ihre eigene Geschichte. Sie sagen „wir“, weil sie für die Toten mit sprechen. Es sind sehr bescheidene, einfache Menschen« – nun aber vor unseren Augen durch Lanzmanns Kamera in die Position jener ganz Besonderen gerückt, die das Jenseits sahen und zurückkommen konnten; beladen mit der Kenntnis des Ungeheuren – was in der abendländischen Mythengeschichte ein Privileg war, nur ganz wenigen Auserwählten vorbehalten, Herakles, Orpheus, Odysseus, Aeneas, Vergil & Dante, die den Hades sehen und weiterleben durften; und nun hier, in einem ungeheuren Umschnitt, sehen wir als ihre Fortsetzer die jüdischen Wiedergänger aus den Krematorien, funktionell in eine Reihe gestellt mit jenen mythischen Heroen; in Lanzmanns Shoah-Film jedoch anti-heroische, gequälte, mehrfach gestorbene Zeugnisträger des ungeheursten Verbrechens, dessen die graecophile abendländische Kultur auf dem Höhepunkt ihrer »klassischen Moderne« fähig war; exekutiert von einer Herren-Rasse, mäßig gebildeten aber hochgerüsteten Techno-Germanen in Schwarz. Ein Bild gibt ihnen Lanzmann nicht in seinem 9 ½-Stunden-Film von diesem Ereignis ohne Präzedenz.
Ohne Präzedenz auch der Name des obersten der graecogermanischen Töter: ein Tischler macht Tische, ein Sattler Sättel, ein Himmler macht – Himmel? Nein, getreu dem Gesetz, nach dem die Nazis alles Lebendige unter der Sonne ins genaue Gegenteil verkehrten, öffnete dieser Himmler alle Höllentore. Höllentore, durch die er Straßen baute und Schienen legte; Schienen, auf denen Lanzmanns Kamera, montiert auf Lokomotiven oder auf Lastwagen, nun einfährt ins Höllen-Jenseits, uns mitnehmend in die Finsternis, aus der er einige geisternde Untote zu bergen vorhat; Wiedergänger ihrer selbst, die uns sehen und hören lassen, was ihnen angetan wurde vom deutschen Ausrottungsplan alles »Jüdischen« in Europa.
Lanzmanns filmische Arbeit, die nicht aufgeht in Erinnerungsarbeit, hat vier zentrale Bestandteile. Alle arbeiten daran, eine materielle Vergegenwärtigung von Vergangenem zu inszenieren; a) das Aufsuchen der tatsächlichen Orte der Vernichtung; b) die Fahrbewegung der Züge/der Kamera dorthin; in Tsahal, seinem Film über die israelische Armee, benutzt Lanzmann die israelischen Panzer als Transportmittel seiner Kamera; c) das von Lanzmann in spezieller Art und Weise in Gang gesetzte Sprechen der Akteure, der Opfer, Täter oder Augenzeugen; und d) deren neue Verbindung mit jetzigen Lebenden und jetzigen Umgebungen in einer „Re-Inszenierung“ von Ereignissen.
Die Re-Inszenierungen können relativ locker passieren, beinahe improvisiert, wie mit der polnischen Bevölkerung des Städtchens Grabow vor der Kirche von Chelmno (ermöglicht durch ihr fehlendes Schuldbewusstsein; die katholische Kirche hat ihnen die Absolution erteilt). Öfter aber gelingt sie nur nach langem Anlauf und gegen größte Widerstände. Der erlebte Schrecken sitzt zu tief. »Ich kann nicht«. »Ich will nicht«. »Es geht nicht« hört Lanzmann von den Zeugen der Shoah, die er mit Mühe vor seine Kamera gebracht hat.
In der Vorrede, die er seinem jüngsten Film, Der Report Karski, voranstellt, vergleicht Lanzmann seine Gefühle beim Auffinden jedes weiteren lebenden Opfers und Zeugen der Shoah mit dem Glücksgefühl eines Archäologen, der nach langer Suche ein verschollen geglaubtes Meisterwerk entdeckt. Wie ein solches archäologisches Fundstück verhalten sich »die Ausgegrabenen« dann auch. Sie sind erstarrt, verängstigt, schweigend, unwohl im Licht der Kamera. Warum sollen sie den Schrecken, der zwar nicht untergegangen ist in ihren Körpern, den sie aber beerdigt, abgekapselt, notgedrungen und notdürftig bedeckt haben, um irgendwie weiter existieren zu können, hervorholen und neu beleben, wie die Re-Inszenierung, die Lanzmann in Gang setzt, verlangt? Nein, sie wollen das, zunächst, nicht. Und bloße Interviewtechnik käme da auch nicht heran. Lanzmann kommt aber heran und wir sehen und hören: das Erlittene ist nicht verdrängt, es ist auch nicht verwandelt und unkenntlich gemacht, wie Lanzmanns drängendes und schließlich erfolgreiches Bemühen um dessen Ausgrabung zeigt. Und wir fragen uns: Wie stellt er dieses Wunder an?
Erste Erkenntnis: der psychische und neuronale Vorgang, den wir (eher leichthin) mit »Erinnern« bezeichnen, ist keine Leistung des sog. Gedächtnisses; er ist vielmehr eine Arbeitsform, das Resultat einer Arbeit zwischen Zweien; Produkt eines Vertrauens, das zwischen den Zweien hergestellt wurde. Vertrauen als Basis einer Zusammenarbeit, die nur sekundär zu tun hat mit dem Funktionieren des sog. Gedächtnisses und seiner Kapazitäten, seinen „Lücken“ oder was immer: diese schließen sich bzw. öffnen sich, sobald die Arbeit beginnt; die zur Kunstarbeit wird spätestens durch die Anwesenheit des beteiligten Dritten, der Kamera.
Man realisiert: Der bekannt berüchtigte Satz deutscher Täter: »Das weiß ich nicht mehr; das habe ich vergessen« bezeichnet überhaupt keinen Sachverhalt des „Gedächtnisses“. Er bezeichnet eine Arbeitsverweigerung vor der Geschichte.[1] Unterstrichen von der ihnen eigenen Kameraphobie.
Die Kamera: genügt ihre technische einfache Anwesenheit, eine Kunstarbeit aus der Arbeit der vor ihr Sprechenden zu machen? Nein, sie genügt nicht. Es ist die spezifische Verbindung, die Lanzmann und seine Gesprächspartner mit dem Aufnahmegerät und den Leuten, die es bedienen – oft renommierte Kameraleute wie William Lubtchansky[2] – eingehen. Dies ist der zentrale Punkt seines Arbeitsverfahrens. Lanzmanns gesamte Tätigkeiten laufen zusammen in seiner Präsenz vor der Kamera, Präsenz seines Körpers und zweitens die Präsenz seiner Stimme. Was er von den Menschen, zu denen und mit denen er spricht, möchte, sind Wörter. Wörter, von denen er weiß, sie liegen in ihnen; aber sie sprechen sie nicht aus; sie wollen oder können sie nicht aussprechen. Und er möchte sie aus ihnen hervor holen. Er selbst ist dabei meist außerhalb des Bildes oder aber leicht angeschnitten im Bild; nicht einfach als Fragensteller, sondern als eine Art Mitspieler, um nicht zu sagen Schauspieler, als acteur. Was in Lanzmanns Filmen zu sehen und zu hören ist, geschieht in ihnen vor der Kamera.
Solange man von Lanzmanns Filmen nur Shoah gekannt hat (und für lange Zeit kannte man nur diesen), konnte oder musste man meinen, Claude Lanzmanns Haltung beim Sprechen sei die besondere psychische Qualität eines jüdischen Filmemachers, der mit besonderer Vorsicht und in allem Faktischen sehr gut vorbereitet, die genauen Umständen der Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis zu erkunden sucht; sich ihnen zu nähern, ohne seine Gesprächspartner zu sehr zu verletzen. Aber eher grob zu werden da, wo er auf die Abwehr- oder Lügengeflechte von Tätern und Mittätern stieß.
Sieht man aber seine anderen Filme, sieht man heute seinen ersten Film Pourquois Israel, erkennt man, dass die spezifische Qualität von Lanzmanns Sprechen vor der Kamera schon 1972, also vor den Aufnahme zu Shoah, voll entwickelt ist; daß die Eigenart seines Sprechens also nicht ursächlich gekoppelt ist an das Sprechen mit den Opfern der Shoah. Seine Rede nimmt vielmehr jene Gestalt an, die sein jeweiliges Gegenüber braucht, um aus sich heraus zu kommen und die eigene Rede zu finden. Damit ist dieser prinzipiell kein Interviewter mehr und Lanzmann kein Interviewer. Funktionell ist er tatsächlich Actor, er zaubert jenen Schauspieler aus dem Hut (d. h. aus seinem Körper), den die jeweils anderen brauchen, um selber zum Darsteller der eigenen Existenz werden zu können; d. h. auch: sich selber vor der Kamera funktionell zu verdoppeln.
Sie gelangen damit auf jene Ebene von Künstlichkeit/Kunst, aus der allein das entspringt, was naivere Gemüter gern Authentizität nennen, diese dann aber gern verwechseln mit »Natürlichkeit«. Lanzmann scheint demgegenüber von Anfang an – vom Anfang seines Filmemachens an – zu wissen, dass Authentizität (die er selber lieber Wahrheit) nennt, zu bekommen ist nur als Produkt einer Kunstarbeit. In deren Zentrum wirkt bei ihm die angesprochene Dreier-Koppelung: sein eigenes Reden in Verschlingung mit dem Reden des Angesprochenen, ausgeübt vor einer laufenden Kamera und deren Bedienung.
Das Rätsel der besonderen Präsenz von Lanzmann vor der Kamera ist damit aber erst angetippt. Was geschieht tatsächlich? Allen Beteiligten ist bewusst, dass aufgezeichnet wird, was sie da sprechen; und zwar auf einer Ebene, die ihre jeweiligen Absichten übersteigt. Die Gesprächspartner wissen: Wir filmen hier; und zwar nicht irgendwelche Absichten, sondern ein Verhältnis zwischen mir/uns und dem zu uns sprechenden Lanzmann. Ein Verhältnis, das von dieser Kamera nicht nur beeinflusst, sondern entscheidend hergestellt wird. Dies Bewusstsein (selbst wenn es ein unbewußtes bleibt) wird von Lanzmann durch seine Art, vor und mit der Kamera zu leben, hergestellt. Er ist immer genügend dicht an seinem Gesprächspartner, sei es »dicht« im Sinne von „auf die Pelle rücken“ oder auch „dicht“ im Einhalten von Distanzen; »dicht« im Sinne von „weiter darf ich hier nicht gehen“, „hier würde ich verletzend“ oder aber „hier sollte ich verletzend werden“. Ständig erhöht er damit die Anwesenheits-Intensität des Partners wie auch die eigene. Aber das Ganze hängt an der Akzeptanz, die die Anwesenheit seines Körpers durch sein Gegenüber erfährt.
Die meisten der Sprechenden, besonders die »Toten«, die aus dem Jenseits der Shoah zurückgekehrt sind, brauchen Schutz. Menschliche Körper liegen in ihnen vor als Leichen, als Asche; oder als die Körper der Täter, gewalttätige, übergriffige Körper in Uniform. Ein Körper, zu dem sie bereit sind zu sprechen, muß andere Qualitäten haben, eine andere Beschaffenheit. Lanzmanns Körper ist kein leichter, schwebender. Er ist ein Körper von Gewicht. Die Drohung, die potentiell von seiner Statur ausgeht, muß er im Gespräch umwandeln in eine andere Art Gewicht; in die Sicherheit einer Schutzfunktion. Oft betont er in Interviews: »ich richte nicht, ich urteile nicht« – wenn etwa Täter, mit denen er spricht, sich zu rechtfertigen beginnen. »Ich möchte etwas von Ihnen…Ihre Kenntnisse…das, was Sie gesehen haben«. Das ist die eine Grundlage. Was wir zuerst mitbekommen beim Sehen und Hören: Lanzmanns Anwesenheit strahlt eine Ruhe aus und ist beruhigend. Formulierbar in einer Reihe einfacher Sätze: »Wir sitzen hier in einer geschützten Zone«. »Hier wird nicht getötet«. »Hier ist ein Ohr«. »Ein Mund, der antwortet«. »Mein Körper kann viel aufnehmen. Ich werde nicht zerbrechen«. Mehr: »Mein Körper wird Sie halten«, bzw. in der dritten Person, in der Lanzmann oft spricht: »Mein Körper wird ihn halten«. Und: »Er ist nicht allein mit mir«. »Da steht eine Kamera und der, der sie bedient«. »Da die Dolmetscherin«. »Hier bricht nichts Plötzliches herein«. »Er ist hier gut aufgehoben«.
Hinzu kommt, was wir im fertigen Film nicht sehen: die Reihe der Vorgespräche, all die Vertrauen schaffenden Annäherungen und Kontaktaufnahmen, das vorsichtige Beseitigen von Widerständen. Was wir aber sehen im Film jetzt: die Nähe ist hergestellt, die Dichte ist da. Das ganze Setting ist wie eine gelungene Verdichtungsapparatur von tragender, schützender Qualität; mit einem Körper im Zentrum, der eine Versicherung darstellt gegen den Weltuntergang.
Die Frage, »wie er es denn anstellt«, wie seine Kunstarbeit beschaffen ist, ist damit vielleicht im Ansatz beantwortet; ein Rest Geheimnis bleibt. Nächste Frage: Was genau tut dabei die Kamera. Ich empfinde es so, als ob die Kamera durch das aufgeladene Beziehungsgeflecht zwischen den Sprechenden ebenfalls eine Art Verlebendigung erfährt: eine Apparatur, die nicht nur »aufzeichnet«, sondern mitfühlt und mitdenkt, was die Protagonisten da vor ihrer Linse tun; sie, bzw. die Kameraleute, drücken dies aus durch die sehr vorsichtigen Bewegungen, mit denen sie die Gesichter der Sprechenden abtasten; wo geht sie näher, wo »macht sie auf«; wo bezieht sie das Gesicht oder den Körper Lanzmanns ein ins Bild; wo bleibt sie bei seinem Gegenüber. Nie fuhrwerkt sie herum; aber öfter schwankt sie stark, besonders bei Bewegungen draußen. Drinnen ist sie Teil des beruhigenden Settings; gleichzeitig aber sagt sie: »Er/Sie soll hier Zeugnis ablegen. Er ist der Einzige, der das kann«. »Wenn er hier nicht spricht, ist es für immer verloren, was nur er weiß«.
Auf der Seite der Sprechenden hat das den Effekt, dass sie wissen, der aufnehmende Apparat wird sich von irgendeinem Geschwätz, das sie absondern, nicht täuschen lassen, selbst wenn sie das wollten; er wird vielmehr genau dies offenbaren. Die Kamera-Apparatur wird damit so etwas wie ein ausgelagertes Gesamt-Hirn der Sprechenden; und gleichzeitig das Offenbarungsgerät ihrer Gefühle. Was bedeutet: ohne Kamera ginge dies Verfahren nicht. Nicht nur, dass dann kein Film entstünde. Nein, das Sprechen käme auch nicht. Die Wörter blieben verborgen, oder ganz andere kämen. Alles würde wie Musik, die verschwunden ist, sobald verklungen; es ginge dahin, wie Worte im Wind. Hier aber wird Zeugnis. Vor und in der Kamera.
Die Weigerung des Regisseurs Lanzmann, bei der Montage seiner Filme fremdes Dokumentarmaterial zu verwenden, Wochenschauen, Filmausschnitte sowie die Vermeidung von Techniken wie Voice over oder Kommentar aus dem Off erklären sich allesamt aus diesem Kontext. Sie würden die körperliche Intimität seines Settings zerstören. Die Intimität, die dem Setting einer Psychoanalyse ähnelt; mit dem Unterschied, dass Lanzmann nicht auf die frei fließende Assoziation »des Patienten« zielt, sondern auf dessen Zeugnis, das sich auszeichnen möge durch höchste Präzision im Faktischen. Was seine Schutzfunktion angeht, seine Haltefunktion, wie der Psychoanalytiker Winnicott dies nennt, gleicht er aber einem solchen.
Von Lanzmann vor der Kamera verlangt dies, sollen die Gespräche gelingen, ein hohes Maß an Flexibilität wie auch an ruhiger Beharrung; man könnte auch sagen, an körperlicher und emotionaler Verwandlungsfähigkeit, die gleichwohl so gut wie unsichtbar bleiben muß. Der Verwandlungskünstler, der acteur, der in ihm an der Arbeit ist, darf sich (sehr oft) nicht offen zeigen. Aber wir können genau sehen – und ich sehe es mit Bewunderung – wie Lanzmann in seinen jeweils verlangten Rollenwechseln (die keine sind; sondern Körperverwandlungen), einen professionellen Actor/Director wie Woody Allen, der all dies permanent ausstellt, an Virtuosität mit Leichtigkeit übertrifft.
Lanzmanns eigene Termini dazu lauten etwas anders. Hamburg, Januar 2009: »“Warum Israel“ ist in keiner Weise ein Propagandafilm. Er beschönigt nichts und zeigt auch Dinge, die bei dem Versuch der Staatenbildung Israels nicht funktionierten. Ich kann allerdings nicht verleugnen, dass ich den Film mit einer emphatischen Haltung gedreht habe – auch wenn ich Leute reden ließ, die Sachen sagten, die mir nicht gefielen. Meine emphatische Haltung und meine Suche nach Wahrhaftigkeit sind zwei Gründe, warum der Film seit seiner Premiere beim Filmfest in New York im Jahr 1973 zwar gealtert, heute aber nicht veraltet ist. Man kann ihn immer wieder sehen, weil seine Wahrhaftigkeit ihm eine gewisse Unsterblichkeit verleiht«.
Die »Unsterblichkeit« ist die der darin eingegangenen Kunstarbeit; was ich Acting nenne, nennt er Empathie. Empathie bezeichnet genau die Fähigkeit, vor (und mit) der laufenden Kamera zu bemerken, welche Art der Ansprache sein Gegenüber braucht, um selbst artistisch produktiv zu werden. Es ist die Zusammenschaltung der eigenen Psyche(n) mit der Präsenz der Kamera, die die nicht verschwindende Aktualität dieser Sorte Filme ausmacht. Aktuell, weil psycho-physisch wie technisch-artistisch gegenwärtig. Das gilt so für alle Filme von Claude Lanzmann.
Filme, die in der Tat unentwegt Spielfilmszenen produzieren, wie es besonders gut in Pourquois Israel und in Tsahal, Lanzmanns 5-Stunden-Film über die Notwendigkeit der israelischen Armee[3], zu studieren ist. Er ist dabei in seinem Insistieren keineswegs immer freundlich; manchmal eindringlich und auch aufsässig, je nachdem, mit wem er spricht und wozu er spricht; immer aber auf der Suche nach einer Redeweise – einer Körperhaltung – die dem Moment und der jeweiligen Person angemessen ist. Die Kamera als der nicht nur aufzeichnende, sondern eingreifende Dritte bewirkt dabei immer eine Intensivierung des „Aggregatzustands Realität“. Die emotive wie intellektuelle Aufladung der Gesprächsmomente vor der Kamera, Lanzmanns souveräne »mediale« Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsverläßlichkeit, gibt dem Betrachter, gibt uns auch dreißig Jahre später die Formulierung „nicht veraltet“ ein.
Den Unterschied zu anderen Medien benennt Lanzmann selbst. Im Zeitungsartikel würde dieses »Dritte« fehlen. Seine Artikelserie über die DDR kennt heute niemand mehr. Lanzmann merkte: Dasselbe über Israel – das geht nicht. Es gibt Gespräche in „Warum Israel“, die in einem Zeitungsartikel ganz unscheinbar würden, belanglos. Sie gehen als Film. Ebensowenig hätte die Umbruchssituation des Landes in Verbindung mit den eigenen disparaten Schnipseln im Kopf sich gefügt in ein Buch. Im Buch stünden die Gespräche der Filme als Übersetzungen.
Wo es ihm angemessen scheint, inszeniert Lanzmann aber auch unverhohlen: Amerikanische Juden, die zum ersten Mal das Land besuchen, werden von Lanzmann im Supermarkt gefilmt, wie sie begeistert verschiedene Waren, Sardinenbüchsen und Thunfischdosen, hergestellt in Israel, in die Kamera halten; Gestus: toll was es hier alles gibt. Im Interview erzählt Lanzmann dazu, wie er die Touristen zu diesem Zweck mit Bussen dort hat hinbringen lassen.
Manche Züge seiner speziellen Rede-Präsenz vor der Kamera könnte man einem Repertoire von Kniffen zuordnen; oder meinetwegen Zaubertricks. Lanzmann: »Bevor ich »Shoah« gedreht habe, sprach ich ein wesentlich besseres Deutsch als danach. Ich habe gewissermaßen mutwillig während der dreizehn Jahre, in denen ich an »Shoah« arbeitete, mein Deutsch verlernt. Das war gut für den Film. Um einen Nazi reden zu lassen, stottern Sie besser, so kann er Ihnen mit den gesuchten Worten aushelfen und Ihnen diese bei der Gelegenheit gleich auch noch ausführlich erklären. Wenn Sie so wollen, war dies eine Methode, die ich angewandt habe. Mit einem perfekten Deutsch hätte ich nie Aussagen jener Qualität von den Tätern bekommen, wie wir sie in Shoah zu sehen und zu hören bekommen«.
Hafenarbeiter in Haifa lockt er mit dem Hinweis auf Einkommensunterschiede, die es in Israel doch gäbe, zu der Aussage, so etwas wie Klassenkämpfe werde es in Israel nicht geben; nicht nur, »weil sie doch alle Juden seien, zufriedene Juden«; nein, weil es »zur Normalität eines Landes gehört, dass es solche mit und solche ohne Geld geben muß«; außerdem seien sie im Krieg. So wie er ein russisches junges Paar, gerade eingereist aus der Sowjetunion, durch sein freundlich bestätigendes Ohr zur Aussage bringt: »In Israel ist es doch ganz furchtbar; Gleichmacherei wie im Sowjetsystem. Bloß schnell weg hier; weiter in die USA«.
Claude Lanzmann, Le Rapport Karski, 2010
Ich möchte zum Schluß noch einen besonderen Fall von Lanzmanns Verfahren beschreiben; aus seinem jüngsten Film Der Karski-Report. Jan Karski war während der Besetzung Polens durch die Nazis ein Untergrund-Kurier der polnischen „Heimatarmee“ zur polnischen Exilregierung in London. Wer Shoah kennt, kennt Karski von dort. Er berichtet in Shoah von seinem Treffen mit zwei Vertretern jüdischer Organisationen im besetzten Polen, die ihm im Oktober 1942 Zutritt zum Warschauer Ghetto verschafften und ihm – in der Maske eines ukrainischen Wachmannes – den Aufenthalt in einem Lager ermöglichten, das er (fälschlich, wie Lanzmann sagt) für das Vernichtungslager Belzec hielt. Karski berichtete, was er gesehen hatte in London, berichtete von den im Stehen sterbenden Juden im Ghetto, und wurde von General Sikorski, Chef der polnischen Exilregierung, weiter geschickt nach Washington, um seine Informationen der amerikanischen Regierung zu unterbreiten. 35 Jahre später dann, jetzt als Geschichtsprofessor in den USA, wiederholt Karski seinen Report vor Lanzmanns Kamera für den Film Shoah – nach großen Widerständen – in seiner Wohnung in Washington.
Jetzt, 2010, hat Lanzmann einen neuen Film daraus fertig gestellt, den Karski-Report; mit Material, das Lanzmann bei ihrem damaligen Gespräch 1978 aufgenommen, aber in Shoah nicht verwendet hat. Jan Karski hatte all die Jahre sorgfältig vermieden, sich mit der Ermordung der europäischen Juden thematisch zu befassen. Erst Lanzmanns nicht nachlassendes Bohren brachte ihn vor die Kamera. Zwei ganze Tage hat Lanzmann damals mit ihm gedreht. Der neue Film zu Karski, jetzt publiziert, enthält Aufnahmen vom zweiten Tag der Aufnahmen; Tag, an dem Karski »ganz anders sprach als am ersten«, wie Lanzmann im Vorspann darlegt.
Sprechweisen: wir sehen den polnisch-amerikanischen Historiker vor der Kamera, wie er, 1978, seine Redeweise reflektiert; wie er wiederholt, was Lanzmann von ihm will: Mitarbeit an seinem umfassenden Film über die Shoah. Obwohl ihn, den damaligen polnischen Leutnant, in erster Linie das Schicksal Polens interessiert hat; wie er sich selbst auffordert, präzise zu sein; konzentriert auf das Schicksal der polnischen Juden. Damals, in London, habe er seinen Bericht abgespult »wie eine Maschine«; nur so konnte er es aushalten.
In Washington angekommen, wird ihm eröffnet, President Franklin D. Roosevelt persönlich möchte seinen Bericht zur Lage Polens entgegennehmen, das ist im Juli 1943. Karski berichtet umfassend. Die Lage der polnischen Juden, erfährt Lanzmann, habe Karski gegenüber Roosevelt aber nur am Ende seines Berichts ansprechen können; mit allerdings einem präzisen Satz, den er genau erinnert: »Mr. President, the situation is horrible. The point is: without help from outside the Jewish people will perish in Poland«.
Darauf sei Roosevelt in seinen anschließenden Fragen aber nicht eingegangen. Er habe nur immer betont, dass es nach diesem Krieg – Karski imitiert Roosevelts Stimme – »after this war« (»this woooaar« mit langem großen »oooaa«) keine Kriege mehr geben werde. »The human race will be organized in such a way that there will be no more woooaars«; und er, Franklin Delano Roosevelt, würde die Schlüsselfigur sein in dieser Entwicklung. Polen würde großzügig entschädigt werden für sein Leiden; etwa mit Teilen von East Prussia. (»Nein, wir wollen das ganze Ostpreußen«, habe der polnische Botschafter Czikanowski, der Karski begleitete, eingeworfen – wozu Karski, 1978 vor Lanzmanns Kamera, laut lacht). Aber »zu den Juden«, ergänzt er auf Lanzmanns Nachfrage, kam von Roosevelt weiter nichts; und wer sei er, Karski, 23-jähriger Leutnant und Kurier der polnischen Exilarmee denn gewesen, ihm, Mr. President, dem mächtigsten Mann der Welt, der auch so auftrat, vorzuschreiben, welche Dinge ihn zu interessieren hätten –
– aber, indem er Roosevelts großen »woooaar!« imitiert, gleitet er, beinah ohne es zu bemerken, in ein akustisches Nacherleben der Situation vom Juli 1943. Die Re-Inszenierung ist in Gang. Lanzmanns Zwischenfragen: sehr behutsam, aber das »Judenproblem« im Bewußtsein – das für Karski eigentlich »sekundäre«. Das dann aber doch nicht sekundär blieb. Denn, Roosevelt hatte doch hingehört – und Karski am nächsten Tag einen anderen Gesprächspartner geschickt, den Richter Frankfurter, den er offenbar für kompetenter hielt in dieser Frage als sich selbst.
Karski schildert nun sein Gespräch mit »Frankfurter«, Richter am Obersten Bundesgerichtshof in Washington, enger Vertrauter und Berater von Präsident Roosevelt. Und kommt erneut auf seine Sprache. Zu Lanzmann, auf Englisch: »Ich weiß, was Sie wollen. Ich weiß, ich muß sehr konzentriert sein, sehr präzise«. Und er beginnt, das Gespräch mit Frankfurter wiederzugeben:
»Frankfurter: „Sie wissen, dass ich Jude bin“«. Karski: »Yes«. »Frankfurter: „Berichten Sie mir, was mit den Juden in Ihrem Land geschieht“«. Karski, zu Lanzmann: »Ich spulte nun meinen Bericht herunter, wie eine Maschine, etwa 20 Minuten; all das, was ich Ihnen gestern erzählt habe«. Das war der Bericht Karskis über die Lage in Polen, den Lanzmann 1985 in den Shoah-Film integriert hat.
Was nun folgt, kennen wir nicht. Lanzmann hat es bei der Montage von Shoah weggelassen. Im Vorspann jetzt zum Karski-Report erklärt Lanzmann, dieses Weglassen habe »rein artistische Gründe« gehabt; der Shoah-Film wäre sonst zu lang geworden. Eine vielleicht etwas merkwürdige Begründung bei einem 9 ½ Stunden-Film.
Karski beschreibt nun, wie Frankfurter, ein sehr brillanter kleiner Mann mit äußerst lebendigen Augen – Lanzmann wirft irgendwann seinen Vornamen ein: Felix – immer kleiner geworden sei beim Anhören seines Berichts von der laufenden Vernichtung der polnischen Juden, in sich zusammengefallen. Unterbrochen habe er ihn nicht. Und dann ‑ »ich erinnere jedes Wort genau, jede Sekunde« – habe Frankfurter geantwortet: »Young man« – mehrfach habe er ihn so angesprochen – »Young man« (und dabei betont, dass er selber »no longer young« sei, dass er die Menschen also kenne, als Bundesrichter und sowieso ); und offenbar hat Frankfurter dies im Stehen gesprochen, damals; denn Karski ist nun aufgestanden von seinem Stuhl und hat begonnen, Frankfurter zu inkorporieren; und dieser Frankfurter – Jan Karski im Stehen, in seinem Haus in Washington 1978 – spricht nun, jedes Wort betonend: »Young man. I don’t believe you«.
Es raubt mir den Atem.
Ein engster Vertrauter und Berater von F. D. Roosevelt, der jüdische Bundesrichter Felix Frankfurter, antwortet im Juli 1943 einem polnischen Augenzeugen der Vernichtung der Juden in Polen – Karski: »ich habe nur erzählt, was ich gesehen habe« – »Young man: I don’t believe you«.
Der polnische Botschafter interveniert empört: »Mr. Frankfurter, die Glaubwürdigkeit des Kuriers Karski ist hundertfach bestätigt; er ist geprüft auf Herz und Nieren. Wollen Sie sagen, er ist ein Lügner?«
Karski (als Frankfurter; wieder stehend): »Nein, ich sage nicht, er ist ein Lügner. Ich sage: I don’t believe him. Das ist ein Unterschied«. Und er erläutert den Unterschied: »Meine Vorstellung, nein, meine Kenntnis of humanity«, habe Frankfurter gesagt, »mein Wissen von der Menschheit sagen mir, das kann nicht stimmen. Das ist unmöglich«.
Wir registrieren: die amerikanische Regierung hatte Mitte 1943 alle Informationen zur Ermordung der europäischen Juden – und nicht nur aus der Quelle Karski, wie wir inzwischen auch wissen:– sie hat diesen Informationen aber nicht geglaubt. Nicht glauben wollen? Das Verbrechen wissend und kalten Herzens geschehen lassen?
»Nein«, fügt Karski nun an, sie hat ihnen nicht glauben können; und er äußert eine Art Verständnis für Frankfurters Reaktion: Er selbst habe alle Sorten historische Probleme mit seinen Studenten behandelt, Serbien, SU, Polen. Aber nie das jüdische. »Ich konnte es nicht«. Er könne es ja selbst nicht glauben, sagt Karski, was er in Warschau und Belzec gesehen habe. »Glauben Sie, jemand in Washington, damals, konnte sich vorstellen, was in Polen geschieht?«, fragt Lanzmann. »Probably not«, antwortet Karski. »Probably not. – Vielleicht, wenn jeder Einzelne von hier wirklich dort gewesen wäre«. Aber – er macht eine Geste zum Kopf – »Mein Hirn, nein, the brain, das menschliche Gehirn fasst es nicht. Es ist nicht so gebaut«. Das alles war unprecedented, ohne Beispiel.
Lanzmann, der nur sehr vorsichtig interveniert hat, um Karskis 1943er Schauspiel mit judge Frankfurter nicht zu stören, hebt nun zu Sprechen an – aber Karski lässt ihn nicht. Er wiederholt seinen Befund vom Hirn, das dies nicht faßt; und Lanzmann akzeptiert – Stille. Pause –
…und läßt den Film – Kamera nah auf Karskis Gesicht – enden hier.
Um den Kommentar zu finden, den Lanzmann vielleicht noch hat geben wollen, müssen wir zurück an den Anfang. Lanzmanns Vorrede zur Begründung, warum dieser Teil des Gesprächs mit Jan Karski erst jetzt erscheint, 2010, enthält einen Satz, den man (am Anfang) nicht recht versteht; nicht recht einordnen kann. »Die Mehrheit der Juden konnte nicht gerettet werden, sobald Hitler seinen Krieg gegen sie eröffnet hatte«, sagt Lanzmann im Vorspann. Nun, vom Ende von Karskis Rede her, »verstehen« wir den Satz: da niemand auf der Welt, niemand für möglich halten konnte (außer den Nazis selbst), was sie vorhatten mit »den Juden«, konnte auch niemand wirklich so dagegen arbeiten, dass es hätte verhindert werden können. Alle menschlichen Nicht-Nazi-Hirne waren nicht in der Lage, das Vorgehen der Nazis zu fassen.
Dies bekommen wir nun als letztes Wort Lanzmanns nach seiner 35-jährigen Film-Recherche zur Shoah: »Es war nicht zu verhindern« – nachdem die Monster aus Deutschland, Hitler, Himmler und ihre Eich-Männer, die Ausrottung der jüdischen Rasse beschlossen hatten.
Aus Shoah weggelassen, weil »zu lang«? Aus künstlerischen Gründen? Ich erlaube mir leichten Unglauben. Eher sieht es so aus, als hätte Claude Lanzmann einen solchen Schluß 1985 seinem Shoah-Film nicht zumuten wollen; weder seinem Kunstwerk, noch all denen, die an ihm mitgearbeitet haben, noch allen lebenden Juden wie auch dem Staat Israel und auch nicht der Menschheit überhaupt: die Unvermeidlichkeit der Vernichtung, beschlossen von deutschen Nazis mittels einer neuen Art Gehirn. Gehirn, dessen Struktur dem Rest der Menschheit intellektuell wie emotional nicht erfassbar war. Eine neue Stufe der Evolution – Evolution zur eliminatorischen Tödlichkeit.
Stufe, deren oberste Organisationsinstanz noch 1957 in Buenos Aires durch den Mund des Mercedes-Benz-Angestellten Adolf Eichmann dem Journalisten W. Sassen aufs Tonband diktiert: »Wir haben leider versagt. Wir haben nur 6 Millionen geschafft von den 10,3 Millionen europäischer Juden. Das war kläglich. Der Zeitgeist war leider gegen uns«.
So gesprochen von Eichmann einige Tage vor seiner Gefangennahme durch den Mossad; wenige Wochen, bevor er, nach Israel ausgeflogen, entschlossen sein »Nicht schuldig!« in die Kameras im Gerichtssaal in Jerusalem ruft. Wenn »schuldig«, dann wegen des Versäumnisses der »nur 6 Millionen«.
Warum im Jahr 2010 dieser Film des nun 84-jährigen Lanzmann? Es gibt tatsächlich einen aktuellen Grund; einen Roman mit dem Titel: Jan Karski, Autor Yannick Haenel, erschienen in Frankreich 2009. Karski, gestorben im Jahr 2000, hatte zu Lebzeiten selber in seinem Buch Story of a Secret State, das war 1944, von seiner Audienz bei Präsident Roosevelt berichtet. Haenel in seinem Roman baut den Bericht von Roosevelts Desinteresse aus zu einer »Karikatur«, wie Johannes Willms schreibt in der SZ vom 25. Jan. 2010. Roosevelt bei Haenel werde »als völlig desinteressiert geschildert, nur mit seiner Verdauung und der Musterung der Schenkel einer das Gespräch protokollierenden Sekretärin beschäftigt«. Dagegen hat neben der Kritikerin Annette Wieviorka auch Claude Lanzmann öffentlich protestiert und dabei – schließlich wusste er sich im Besitz des unpublizierten Filmmaterials – seinen Film Le Rapport Karski angekündigt; der nun da ist und die edition Lanzmann bei absolut medien komplettiert als DVD Nr.10. Darin dieser polnisch-amerikanische Geschichtsprofessor, Alter knapp 60, der im Jahr 1978 Verständnis zeigt, wenn auch entsetztes, dass der judge Frankfurter, hoher Amtsträger der jüdischen Gemeinde Washington D. C. und Berater des Präsidenten F. D. Roosevelt im Juli 1943 die Nachrichten von der Vernichtung der Juden aus Polen mit den Worten bedachte: »Young man…I don’t believe you«.
Es nimmt mir den Atem, so oft ich die Stelle ansehe. Und macht deutlich, dass die Anerkennung der Tatsache Shoah durch uns, die jetzt Lebenden, irgendwie zwar »geleistet« ist, das Wissen von der Tatsache Shoah im Sinne von »I believe you, old man«, weil ich es fühlen und denken kann und es daher weiß, eher noch aussteht. Our brain muß fassen können, was dem Humanitäts-Konglomerat im Kopf von judge Frankfurter nicht möglich war (bzw. von justice Frankfurter, wie Karski ihn auch nennt). Eine bessere Hilfe dazu als die Filme von Claude Lanzmann gibt es nicht. Diesen jüngsten hat er gemacht, um doch ein Stück Wahrheit mehr (diesmal aus dem Encounter von Jan Karski und Franklin D. Roosevelt) in die Welt zu bringen, »die Wahrheit zurecht zu rücken«, wie er sagt in Hinblick auf das Buch von Haenel. Ein bisher weggelassenes Stück; ‑ was von einem gewissen Optimismus zeugt. Es wird Leute geben, die etwas anfangen können damit.
Diese Leute gab es, als Lanzmann Shoah montierte, nicht; vielleicht noch nicht – sagte Lanzmanns Kunstverstand; und seine politische Vorsicht. So wie er – man kann sagen: entsprechend – auch die Geschichte vom erfolgreichen Aufstand der jüdischen Häftlinge im Lager Sobibor aus dem Shoah-Film weitgehend heraushielt. Shoah war der Film vom Tod, vom Sterben. Nicht von Aufständen, gelingenden. Das Material mit Yehuda Lerner, dem damals 16-Jährigen, der einem SS-Mann mit einer Axt den Schädel spaltete, hatte Lanzmann da auch schon aufgenommen. Der fertige Film Sobibor, 14. Oktober 1943, 16 Uhr kam aber erst 2001. Yehuda Lerner mit Familie kam zur Premiere. Und das Publikum konnte geradezu vergnügt reagieren, als es begriff, dass der Aufstand der Häftlinge nur gelingen konnte, weil der Plan dazu auf dem Pünktlichkeitsritual der SS-Wächter basierte, die alle genau zum vorberechneten Zeitpunkt dort erschienen, wo die tödlichen Äxte auf sie warteten. Auch das war nicht der Stoff für 1985.
Möglich also und erwartbar, dass uns weitere solcher Kunst-Stücke erwarten, atemberaubende Ungeheuerlichkeiten aus dem Korpus des von Lanzmann vor Jahren gedrehten 350-Stunden-Materials; als fertige Filme haben wir davon noch keine dreißig. Und: aktuell sich erweiternde Gehirne brauchen Zufuhr von Materialien zur weiteren Entfaltung von Tötungs-Resistenz.
Lanzmann: »Als Jude hatte ich den französischen Antisemitismus vor dem Krieg kennengelernt. Ich war Mitglied der kommunistischen Jugend und der französischen Resistance und habe im Untergrund gegen die Deutschen gekämpft. Nach dem Krieg stellte sich mir die Frage: Wie kann ich hier noch leben, wie gehe ich damit um, wenn mich die Franzosen anlächeln? Ausschlaggebend dafür, dass ich weiter in Frankreich leben konnte, war das Buch Betrachtungen zur Judenfrage von Jean-Paul Sartre, das mir nach dem Krieg, der Angst und der Schande geholfen hat. Eine seiner Ideen war, dass die Antisemiten den Juden geschaffen hätten und dass es ohne Antisemiten auch keine Juden gäbe«.
Diese Ansicht wurde wenig später von Lanzmann als Irrtum erkannt (s. Anfang). Ein Irrtum, der ihn vom Medium Buch aufs Medium Film brachte. Die Freundschaft mit Sartre blieb dennoch, mit Simone de Beauvoir kam eine Liebe hinzu und wir, die Welt, bekamen die Filme.
Es muß nicht immer alles zu Bruch gehen, bloß weil die Beteiligten sich irren. Irren ist nicht nur menschlich, es ist klug. Wenn man das richtige Medium findet.
© Klaus Theweleit
Juli 2010
[1] Von dieser Arbeitsverweigerung haben die Deutschen (in aller Betriebsamkeit ihres Wirtschaftswunders) ausgiebig Gebrauch gemacht haben. Dies Privileg der Arbeitsverweigerung vor der Geschichte (sonst ein Privileg von Machthabern, von Herrschenden), ist der deutschen Nation offiziell, kirchlich/staatlich eingeräumt worden; versehen mit dem Genehmigungsstempel der Alliierten, der neuen politischen Verbündeten nach WW II gegen den »Kommunismus«; durchbrochen (offiziell) nur einmal in einem kurzen Moment von Willy Brandt in Polen.
[2] William Lubtchansky arbeitete u.a. mit François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Agnes Varda, Claude Lanzmann und zehnmal mit Straub/Huillet zusammen. Er starb im Mai 2010 72-jährig in Paris.
[3] Ein Offizier in Tsahal fasst den Befund der Notwendigkeit nicht nur dieser Armee, sondern der Überlegenheit dieser Armee über die Armeen der umliegenden Länder zusammen: »Wir sind ein kleines Land…in seiner Breite von einem Jet in zwei Minuten zu überfliegen…wenn einer unserer Piloten nicht aufpasst, schon hat er eine Grenze überflogen. Überall an den Grenzen sind Gegner, die uns zerstören wollen; nicht Israel „erobern“; nicht 10.000 km weg wie die Falklands oder wie Vietnam. Nein, an unseren Grenzen. Da sind Leute, die sagen, sie wollen uns töten. Wir sollen weg. Wenn sie das sagen, werden sie es versuchen. Das ist unsere Erfahrung. Nennen Sie es Verfolgungswahn. Unsere Erfahrung ist, dass sie es versuchen werden. Sie brauchen nur einen Tag; nach einer gewonnenen Panzerschlacht sind sie in unserem Zentrum«.
***
Deleuze ABCDAIRE
Er wollte nicht ins Fernsehen. Sich nicht sehen lassen unter den Leuten, >die Meinungen absondern<; die vor Kameras reden reden reden – ohne einen Begriff zu haben, wovon; und ohne das Problem zu benennen, von dem sie reden. Problem nicht benannt, weil nicht erkannt: ihm ein Greuel. Gilles Deleuze hat diese Enthaltsamkeit, anders als etwa Kollege Michel Foucault, sein Leben lang durchgehalten. Sie sollte aber nur für die Lebenszeit gelten. Im TV reden auch Tote – wenn man sie rechtzeitig aufgezeichnet hat; und so war es geplant in seinem Fall. Als Deleuze im Jahr 1987, 62 Jahre alt, seinen Job als Philosophieprofessor an der Fakultät von Vincennes, Universität Paris, aufgab, wollten einige der ihm Nahestehenden sich nicht zufrieden geben mit dem unspektakulären Retreat. Sie überredeten ihn, vor einer Kamera Platz zu nehmen, in vertrautem Ambiente, und zu sprechen. Nicht nach TV-Manier, im Ping-Pong-Prinzip (beliebiger) Frage und (beliebiger) Antwort. Sie wollten etwas Besonderes, so etwas wie Gilles Deleuze’ intellektuelles Testament. Er willigte ein unter der Bedingung, dass das Ganze erst nach seinem Tod gesendet würde (sollte das Resultat interessant genug sein). [1]Für den Ablauf erfanden sie eine spezielle Form, ein Gespräch, das sich an dem Medium orientiert, in dem der Autor Deleuze sich zeitlebens geäußert hat: dem Alphabet aus 26 Buchstaben. Von A-Z wurde ein Stichwortkatalog ausbaldowert; für jeden Buchstaben ein einziges Wort, beginnend mit >a wie animal< und endend mit >Z wie Zickzack oder: Blitz<. So dass das Ganze schließlich auf den Namen >ABCDAIRE – Gilles Deleuze von A bis Z< getauft wurde. Die jeweiligen Buchstaben mit dem anhängenden Wort werden vorgebracht von einer einzigen Person, der Journalistin Claire Parnet, ehemalige Deleuze-Schülerin und Autorin, mit der zusammen er auch ein Buch gemacht hat: Dialoge. Man sieht ihr Gesicht (in den ersten Sessions) in einem Spiegel hinter Deleuze’ Rücken; später hört man nur noch ihre Stimme. Die beiden duzen sich. Sie schiebt vorsichtig Fragen nach, sehr genau und gewitzt, bestens im Bilde über die Wendungen und Windungen von Deleuze’ Denken.
Interessant genug wurde es. Beginnen wir mit dem Ende. Claire Parnet führt den Buchstaben >Z< ein mit einer Auflistung großer Philosophen: >Zen, Zarathustra, Leibniz, Spinoza, Nietzsche, BergZon – er muß lachen – und natürlich: Deleuze<. >Ja, Z! Ein toller Buchstabe<, sagt Deleuze – der über Bergson, Spinoza, Nietzsche, Leibniz Bücher geschrieben hat. Nachdem er ein Weilchen gesprochen hat über das Zickzack, die Verzweigung, den Blitz an den Ursprüngen der Welt und des Denkens, fragt Claire Parnet: >Bist du froh, ein Z im Namen zu haben?< Er: >Sehr froh, über die Maßen. Das Z im Namen beglückt mich<. Man merkt, und sie tippt es auch an: er würde es gerne verdienen, in der Reihe der großen philosophischen Z-Träger genannt zu werden; das Urteil wird aber, bescheiden, uns überlassen, den Hörern seiner Rede, der Nachwelt. Deleuze, lächelnd, während er sich am Ende von seinem Stuhl erhebt: >Das war’s dann<; und er bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben bei der Aufnahme der siebeneinhalb Stunden philosophischer Talk, die schließlich dabei herausgekommen sind.
Nun, da sein ABCDAIRE zum ersten Mal in einer deutsch untertitelten Fassung vorliegt, ist es an uns, etwas damit anzufangen, etwas daraus zu machen. Wer braucht Philosophen? Deleuze, selbstironisch in Richtung Zuschauer: >Wenn Sie dies hören, bin ich ja schon reiner Geist. Wer mal Tischerücken gemacht hat, weiß, dass „reiner Geist“ nicht sehr tiefsinnig spricht. Also fangen wir an<.
Es geht los mit >a wie animal<. Wer Bücher von Gilles Deleuze kennt, insbesondere die, die er mit Felix Guattari zusammen geschrieben hat – er spricht von ihm durchgehend als „Felix“ – also den Anti-Ödipus und die Mille Plateaux (1000 Plateaus oder 1000 Platos; er liebt doppelte Lesarten), kennt das Deleuze’sche Konzept vom Tier-Werden. Tier-Werden bei Kafka, sich ent-personalisieren, ein Territorium abstecken…Der Bau…die Metamorphosen …die Wahrnehmung: >ein Tier liegt immer auf der Lauer, wie der Schriftsteller<…die Zecke…>eine Welt haben aus drei Bestandteilen: Licht, Geruch, eine unbehaarte Stelle finden am Körper des Wirts<.
Deleuze’s französisches Wort für Begriff ist Concept. Gleich beim animal tauchen zentrale Konzepte auf: Territorium und Deterritorialisierung. Ein Territorium verlassen…seine Zeichen löschen…das Wort >outlandish< bei Melville…der Schriftsteller schreibt auf einer Grenze…die Syntax an eine Grenze treiben…eine ist die Grenze zum Tier. Nun eine überraschende Wendung: für jemanden schreiben ist doppeldeutig. Man schreibt für Leser (vielleicht). Man schreibt aber auch an Stelle von. Man schreibt für die, die nicht schreiben können; so zitiert er Artaud (immer aus dem Kopf; keine Bücherstapel); Artaud also, großartig: >Ich schreibe für die Analphabeten, die Idioten, die Wilden<; d. h. anstelle der Analphabeten; anstelle des Schreis, den sie nicht formulieren; anstelle des Sterbens des Tiers, das dieses nicht ausdrücken kann.
Das ergibt den ersten Hauptbefund: >Schreiben ist keine private Angelegenheit, es ist eine universelle<; der Krebstod der Großmutter – das ist kein Roman. Schreiben anstelle des Schreis, des Piepsens der Josefine, Kafkas Mäuse-Sängerin…nicht: das Private. Man erfährt aber doch, dass er (privat) Haustiere nicht schätzt, die gezähmten. Daß aber die Tochter eines Tages ein kleines Katzenbündel angeschleppt hat; und >seitdem war immer eine Katze im Haus<.
Was Vlado Kristl (der übers Schreiben ähnlich dachte) in einem Gedicht angemerkt hat zu „Rednern an Podien“: >Plaudert sich warm<…die Gefahr war natürlich gegeben…bei 7 ½ Stunden. Zumal, da niemand ihn gebremst hätte. Wann ein Buchstabe >zu Ende< besprochen ist, bestimmt jeweils er. Der nächste ist >b wie boisson< (Getränk. Das Trinken); wozu er eine Menge zu sagen hat (>Du hast viel getrunken<. >Ja, sehr viel<. >Und du hast aufgehört<. Über die Umstände des Aufhörens hören wir nur so viel, dass es überwiegend gesundheitliche Gründe waren; unter m = maladie, Krankheit, erfahren wir von seiner schweren Tuberkulose).
Aber, ob bei b=boisson oder m=maladie, die Bemühungen, eben nicht ins Plaudern zu geraten, sondern die Begriffe, das Concept, die Gründe, warum etwas zur Sprache kommen soll, nicht aus den Augen zu verlieren, ist jeden Moment präsent. Er möchte präzise sprechen, aber doch locker. Auch in Widersprüchen, der Glanz im Auge ist ein ironischer (durchsetzt von Melancholien); und immer wieder Ausfälle gegen Leute, die reden reden reden ohne etwas zu sagen; der Horror seines Lebens.
Trinken: beim Alkohol geht es um das Konzept des letzten Glases…nein, des vorletzten Glases…wie erreiche ich das letzte Glas (nicht)…beim letzten (ultimum) würde er zusammenbrechen…Claire Parnet: >Alkoholiker sagen immer, ich höre morgen auf<. Deleuze: >Nein, sie sagen ich höre heute auf…um morgen wieder anfangen zu können<…Konzepte des Seriellen…die letzte Seerose (gemeint ist die von Monet) wiederholt nicht die erste…nein, die erste ist schon eine Wiederholung – sagt Peguy (den er mehrmals zitiert. Charles Peguy, auf den sich auch Jean-Luc Godard oft beruft; in Deutschland ziemlich unbekannt). Die Alkoholiker…was für Strategen…der Alkohol und das Schreiben: die großen Amerikaner, Lowry, Faulkner, Thomas Wolfe, Algren. Schriftsteller und Alkohol gehören zusammen. Warum? Weil sie etwas spüren im Leben, das größer ist als sie; und das sie ohne Alkohol nicht ertragen. Der Alkohol lässt einen glauben, man begibt sich auf die Ebene dieses Stärkeren des Lebens. Wie auch andere Drogen, erweitert Claire Parnet. >Oui, Drogen überhaupt<. Sie erinnert ihn an die Irren von Vincennes – gemeint sind seine studentischen Zuhörer Anfang der Siebziger – fast alle auf Drogen: ob er seine Verantwortung für sie gespürt hätte. Nein und ja, anwortet er. >Keine Vorschriften. Jeder soll schlucken was er will und kann. Ich bin kein Richter, kein Polizist, kein Priester<. Sie hakt nach: was ist mit den Ausgeflippten. Das bringt ihn auf einen Kernpunkt: schrecklich, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten. Transgressionen, Ausbrüche, ja. Aber >es darf nicht sein, dass aus jungen Drogennehmern Wracks werden<. Dieser Punkt treibt ihn um. Man entnimmt, an dieser und an vielen anderen Stellen, sein Leben war/ist Arbeit. Arbeit ist ein Grund-Konzept. Und zwar philosophische Arbeit, seit ein Lehrer in der Schule namens Halbwachs ihn zuerst auf die Literatur und später ein Professor ihn auf die Philosophie gebracht haben und er sofort wusste: ich will nie mehr etwas anderes machen. Und so hat er es gemacht, nie nichts anderes. Die Vorstellung, junge Menschen, seine Studenten, könnten diese Fähigkeit verlieren bzw. verloren haben, und dies womöglich auf Grund seines Einflusses, trifft ihn. Man realisiert: Claire Parnet sitzt da nicht als Gefälligkeitsfragerin, als Stichwortgeberin, sie weiß sein Leben, kennt die heiklen Punkte, sie spricht sie an, höflich, schonend, aber zieht nicht zurück, wenn er zuckt.
Was hat es auf sich mit dem Konzept Arbeit; dem Konzept philosophische Arbeit, was für Deleuze Begriffsschöpfung ist. >Begriffe findet man nicht vor<, entwickelt er, sie liegen nicht verborgen vor in den Dingen als ihnen zugehörig; >man erfindet sie, man erschafft sie, wie ein Maler ein neues Bild erschafft, ein Musiker neue Klänge. Es ist création, Schöpfung<. Allein in solcher Schöpfung liegt, Deleuze’ 7 ½-stündiger Rede zufolge, eine Art Glück – im Durchbruch der Wahrnehmung (perception) zur Erkenntnis und Aufnahme von etwas Neuem, dem Kunst- oder Wissenschafts-Schönen; wobei er das Schöne der Künste dem Schönen des Denkens prinzipiell gleichsetzt. Für die Künste nennt er das, was in der Philosophie concept heißt, ein percept. Künstler fügen Perzepte neu aneinander und erfinden neue; das geht nicht mit bloßer Inspiration oder Konspiration, das geht über Arbeit (man erinnert sich: über Transpiration, hat Edison dazu gesagt). Wem diese Fähigkeit abhanden kommt, der lebt nicht; dem entgleitet, im Sinn dieses Begriffs von Arbeit, das Leben; und, sollte man daran Schuld sein, hätte man den Betroffenen umgebracht.
Eine andere Art >Schuld< hingegen gilt es abzuschütteln; die Schuld, die >Erbsünde<, die das Christentum in unsere Kultur gebracht hat. Nietzsche ist ihm der bewunderte Philosoph u. a., weil er als erster gegen diese falsche Schuld und falsche Transzendenz angeschrieben hat; zweitens, weil ihm das philosophische Schreiben ein Gesang ist. Deleuze ist kein Mann der philosophischen Systeme; man soll keine Begriffe auswendig lernen und herunterbeten. Von seinen Begriffsbildungen fordert er ausdrücklich, sie zu verändern, sie zu benutzen nach Kontext und Umständen. Jeder soll sich die Begriffe hinbiegen, wie er sie brauchen kann für sich; aber nicht beliebig, sondern als Resultat seiner Arbeit; sonst wird es Blödsinn; sonst landet man bei denen, die reden reden reden…auch Vortragsreisen konnte er nicht ausstehen; nur einige wenige, Amerika, Libanon, stehen zu Buche. Überhaupt reiste er nicht gern, zum Leidwesen seiner Frau Fanny.
Was bedeutet am Begriff arbeiten? Beispiel (er gibt gern Beispiele): Plato z. B. entwickelt den Begriff, das Konzept der Idee – warum entwickelt er es? Unter jedem Be-griff, führt Deleuze aus, liegt ein Problem. Meist wird dies Problem nicht erkannt und also auch nicht benannt, wenn man über den Begriff spricht. Das Konzept der Idee allein zu erörtern, philosophiegeschichtlich, ist unnütz, unsinnig. Das Konzept der Idee als einzelner beruht auf dem Problem der Rivalität. In den jungen Demokratien der griechischen Stadtstaaten gibt es das Problem der Bewerbung. Amtsträger werden nicht mehr ernannt, wie in den voraufgegangenen Königtümern. Bewerbung heißt: Rivalität, Konkurrenz. Ideen konkurrieren. Ohne dies Problem zu erkennen, ist eine Erörterung des platonischen Begriffs der Idee bodenlos.
Damit sind ein paar Punkte angerissen; wir sind erst beim Buchstaben b=boisson und c=culture. Manche Komplexe tauchen immer wieder auf, werden umkreist und präzisiert, andere verschwinden. Das berührt noch so einen Punkt mit dem Reden: manche Hörer seiner Seminare hoben gleich immer den Arm, wo etwas auftauchte, das sie nicht gleich verstanden, und wollten es gleich noch mal wissen, genauer, einfacher. Ein anderer Typ Student dagegen wartet ab, wartet eine halbe Stunde; dann hat sich das Problem (meist) schon geklärt. Letztere sind ihm lieber. Aber, sagt er, da war ein neues Publikum in Vincennes nach 1968, am Anfang der Siebziger, nicht nur Studenten kamen, sondern junge Maler, Architekten, ältere Hörer mit fertigem Studium, eine bunte Mischung der Altersgruppen, um zu hören, was sich Neues tat im Gefolge des 68’er Durchbruchs. An dessen Bedeutung hält er unbeirrt fest. >Es gibt arme Zeiten und reiche<; die Zeit von 1960 bis 1975 war eine reiche; Menschen in ärmeren Zeiten sind benachteiligt; sie merken zwar nicht, was ihnen entgeht, weil es einfach nicht da ist; aber es schadet ihnen. Gerecht ist das Leben nicht.So wie er über einen Begriff wie >Menschenrechte< nur spotten kann. Es gibt Rechte, es gibt Rechtsprechung, konkrete; Jurisprudenz, an der kann man etwas ändern, bewirken. Der Rest ist Gerede, auch für die von Türken ermordeten Armenier. Die politische Schiene, von größter Klarheit: klar scheitern alle Revolutionen, was sollen sie sonst tun. Die englische Revolution bringt Cromwell hervor, die französische Napoleon…die amerikanische? Vielleicht noch Schlimmeres … Reagan heute…usw. Klar kann es keine linken Regierungen geben. Wer das nicht längst weiß, dem ist nicht zu helfen. Dazu brauchte man keinen Stalin, keinen Glucksmann. Im Moment der Macht werden die Sieger zu Herrschenden. (Nachhilfe für debile Grüne, Fischer-Künast-Claqueure).[2] Trotzdem aber: revolutionär werden, widerständig werden, links werden (frz. devenir). Es ist das Moment des Werdens, das die Umstürze schafft. Wenn es einen >Zentralbegriff< gibt bei Deleuze, ist es der des Werdens. Bei Bob Dylan – der bei ihm nicht vorkommt; Deleuze hängt an Alban Berg, Mahler, Bartok – heißt das: He not busy being born is busy dying. Auf Deleuze-Deutsch: Wer nicht wird, vergeht. Das Jahr 68: der Einbruch des Werdens. Unter den jeweils Werdenden und weiter Werdenden gibt es keine Renegaten; keine Renegaten im eigenen Umkreis. Niemand nimmt da etwas zurück. 68: Der Einbruch der Realitäten. Das Reale kommt. Da gibt es keine Zurücknahmen.
Linksregierungen gibt es zwar nicht; aber, gerade deswegen, offen bleiben für Belange der Linken. Milliarden verhungern. Es gibt linke Gefüge, die das verhindern möchten. Sie sind aber keine Gefüge der Macht. Nie aufhören minoritär zu sein, minoritär zu werden. Der normale Erwachsene, der Stadtbürger, männlich, ist eine Mehrheit: & ist leer. Frau-Werden, Kind-Werden, das war mal minoritär. Aber Frauen, sobald in einer Mehrheit, hören auf zu werden. Sie werden nicht mehr, sie herrschen, wie andere Majoritäten auch. Majoritäten hören automatisch auf, links zu sein.
Die Linke ist vielmehr die Gesamtheit der Prozesse des Minoritärwerdens. Gegenüberstellungen wie links/rechts oder Frauen/Männer ersetzt Deleuze durch ein Begriffspaar wie minoritär/maioritär. Dazu gehört auch: Antizyklisch arbeiten, gegen die Moden. Als alle Marx und Wilhelm Reich fordern und durchboxen, macht er: Hume, Kant, Bergson, Spinoza, Nietzsche. Und 1988 Leibniz.
So füllt er an den Buchstaben des Alphabets entlang die 7½ Stunden mit den Deleuzeschen Kurven, zum Ritornell, zum Nomadismus, zum Begriffspaar Percept/Affekt, zum Rhizom (zu dem er bemerkenswert wenig sagt in dieser Aufzeichnung; wahrscheinlich weil das Ganze als eine Art Rhizom aufgefasst werden soll; er spricht dafür von Netzen und Verknüpfungen, was aufs gleiche hinausläuft.Versammeln wir wenigstens die Liste der Stichworte. Nach dem AB (s. o.) das C wie culture. »Gebildet sein? Nein. Intellektueller? Nein. Ich lerne nur das, was ich für eine Arbeit jeweils brauche. Dann vergesse ich es wieder. Gebildete? Sind entsetzlich. Reden über alles. Umberto Eco. Schrecklich…und sie reisen. Und reden. Über alles. Reden beim Essen mit anderen Intellektuellen…Schreiben ist sauber. Reden ist schmutzig…mochte nie Colloquien.
Begegnungen? Nicht mit Leuten, aber mit Dingen…mit Musik, mit Bildern, mit Filmen, ja. Mit Leuten? Immer eher katastrophal…mit Gruppierungen, manchmal. Im Buch über Leibniz das Problem der Falte. Leibniz: Daß alles auf der Welt nur als Gefaltetes existiert. Seele, in die die ganze Welt eingefaltet ist. Materie ist Faltung. Faltung in der Faltung; Wahrnehmung eingefaltet in die Seele des Einzelnen. Nichts ist ganz entfaltet – und da meldeten sich dann die Papierfalter…ein Verein von ca. 400 Leuten in Frankreich…und es meldeten sich zweitens die Surfer…und sagten »Wir bewohnen die Falten der Natur…die Falten des Meeres«. Großartig…tolle Begegnungen. Aber dafür brauche ich sie nicht zu treffen…Ich lauere aber durchaus auf etwas, das vorbeikommt – Schriftsteller-Zecke – und beiße hinein«). D wie désir (der Wunsch; sein Hauptbegriff gegen Freud; dem Libido-Konzept aber durchaus verwandt); E wie l’enfance (Kindheit; wo man einige Details zu Vater/Mutter erfährt; aber mehr erfährt man über den nie verebbten Abscheu der französischen Bourgeoisie vor der Volksfrontregierung von Leon Blum, die 1935 erstmals bezahlten Urlaub einführte und damit die falschen Leute anschwemmte am Strand von Deauville); F wie fidélité (Treue; wo es vorwiegend um Männerfreundschaften geht; sehr lange, teils lebenslange Freundschaften…die Treue zu Félix…Freundschaft mit Monsieur B., mit dem er jeden Tag telefoniert. Nicht erklärlich über gleiche Ansichten, vielmehr eine Übereinstimmung unerklärlicher Art. Es gibt Leute, da geht einem schon eine Frage wie »Können Sie mal das Salz rüberreichen« auf den Wecker. Und ein anderer kann sagen, was er will und es ist immer richtig. Unerklärlich, ein Rätsel).
G wie La Gauche (keine Linksregierungen, s.o.; und warum er nie in die KPF eintrat, wie sonst alle seine Freunde); H wie Histoire (Geschichte; wie die Philosophie sich entwickelt, eine Geschichte bekommt, von Philosoph zu Philosoph, eine konkrete. Gerade als Philosoph hat er einen bestimmten Horror vor den Wörtern, vor den Begriffen, zunächst. Wunsch: Mit der Philosophie aus der Philosophie herausgehen. Er vergleicht das mit den Malern und ihrem Horror vor der Farbe. Sie haben Angst, sagt er. Van Gogh, Gauguin. Sie haben größte Furcht, sich an die Farbe zu wagen. Gibt es etwas Ergreifenderes? Sie zählen zu den größten Koloristen aller Zeiten. Aber ihr Frühwerk? Kartoffelfarben, Erdfarben. Sie trauen sich nicht. Als sie sich dann trauen, legen sie richtig los. Aber erst durch diesen langen Anlauf hindurch. Ähnlich mit der Philosophie. Ehe man sich an die »Farbe« traut, die Begriffe, braucht es wahnsinnige Arbeit, eine langen Vorlauf. Man steigt nicht so eben in die Philosophie. Voran geht ein zähes Bemühen in den Kartoffelfarben). I wie Idée (>die Idee< verstanden als Entdeckung und Entwicklung eines Neuen an einem Gegenstand; es gibt sehr wenig Ideen; Vincente Minelli entwickelt in seinen Filmen die Idee, dass jemand gefangen sei im Traum eines anderen; sich gefangen fühlen im Traum eines anderen; das ist etwas Unerhörtes); J wie joie (die Freude; höchste Freude ist, das zu entwickeln, was jemand vermag; frz. Wort: puissance; ein weiterer Kernbegriff. Zuzusehen, wie Fähigkeiten ungenutzt brachliegen, ein Gräuel); K wie Kant. (War der Philosoph Leibniz noch ein Anwalt – der Anwalt Gottes – werden die Philosophen mit Kant Untersuchungsbeamte; Kant veranstaltet das Tribunal der Vernunft; und: die Zeit wird unabhängig von der Bewegung, von der Kreisbewegung; Zeit-Linie, Zeit-Gerade; großer Begriffs-Erschaffer…und: »Den Irrtum vermeiden« als die Bewegung der Philosophie. In den Jahrhunderten jeweils ganz verschieden. Im 18. Jhd. gilt: die Illusion entlarven (die religiöse und andere Illusionen; Prozeß der Aufklärung). Im 19. Jhd. dann: das Problem, dass Menschen als die geistigen Geschöpfe, für die sie sich halten, unentwegt Dummheiten von sich geben. Flauberts Thema, Bouvard & Pecuchet); L wie literature (die Literatur; so viel gelernt von Fitzgerald, Faulkner, Melville; natürlich Proust; die Inhalte: egal. Der Stil; wird uns wieder begegnen unter S. Natürlich hält sich Deleuze nie streng an die Grenzen des jeweiligen Buchstaben-Geheges); M wie maladie (die Krankheit; schwere Tuberkulose, seit 1968. Täglicher Tablettencocktail. Aber glücklicherweise ohne Schmerzen. Lob der Pharmazie. Heißt aber: keine Reisen. Schnell müde. Früh schlafen. Die Müdigkeit, sein Hauptproblem). N wie neurologie (Neurologie; wüsste brennend gern, was im Hirn vorgeht bei Entwicklung einer Idee, eines Concepts. Erwartet mehr von der Molekularbiologie als von Informatik oder Kommunikationstheorie. Dies ist in der Tat die Richtung, in der man heute einiges mehr weiß als er wissen konnte, 1988). O wie opera (die Oper; ein Stichwort für Musik überhaupt; Concept der doppelten Lesart. Man kann an etwas herangehen als Profi, aber auch als Ahnungsloser, als Amateur = sein Fall mit der Musik. Affekte, Ergriffenheiten; liebt Edith Piaf. Aber ein Faß ohne Boden. Man braucht zu viel Zeit sagt er) – was Quatsch ist; zum Lesen der Philosophien und Literaturen braucht man viel mehr. An Edith Piaf lobt er, dass sie immer mal einen Ton »falsch« singt, ihn sozusagen falsch avisiert und dann zu ihm findet; das machen alle großen Pop- und Jazzsänger. Der »richtige« Ton ist ein frühklassisches Hirngespinst, Bach-Kram. (Weiter Opera: »Kräfte hörbar machen. Mächte des Werdens«. Wie Klee sagt: »Nicht das Sichtbare zeigen, vielmehr das nicht Sichtbare sichtbar machen«. Claire P: Du gehst nicht in Konzerte, aber dauernd in Ausstellungen und Filme. »Nein, weil es zu aufwendig ist. Man muß seinen Platz reservieren, und dann sind sie zu lang. Erregen aber Emotionen, immer. Und dann das Schreiben. Über Musik zu schreiben, ist noch schwieriger als über Malerei. Über Musik ist fast schon das höchste…der Schrei interessiert mich, grenzenlos…Alban Berg. Horizontaler Schrei: Wozzeck. Vertikaler Schrei: die Comtesse in Lulu, das Höchste). Für mich erstaunlich, daß er nicht beim Hören von Musikern wie Sun Ra gelandet ist, oder Eric Dolphy, Alber Ayler. Der Schrei als Befreiungskraft. Sie sind musikalisch immer merkwürdig klassisch, diese Avantgarde-Franzosen; Godard auch: immer Mozart und Beethoven; Foucault dann bis Wagner. Die Schreie der Opernsängerinnen sind mir immer wie zwanghaft umgewandelte Folter erschienen; kein Befreiungsgefühl. Währende die Ausbrüche von Albert Ayler oder Marshall Allen bei Sun Ra die Befreiung des Schreis, seine Entfesselung zum puren Ausdrucksmedium, zu reiner Schönheit sind.(Weiter Opera: den Schrei gibt es auch in der Philosophie: Spinoza; was kann ein Körper. Der Gesang in der Philosophie, das sind die Begriffe. Gesang/Schrei und Begriff/Affekt, das ist dasselbe). Schöner Satz. P wie professeur (der Professor: hat liebend gern gelehrt, vermisst es nun aber nicht. Bedingung der Vorlesung: beste Vorbereitung, sonst kein Enthusiasmus beim Redner. Bewunderung für die Hörer, die immer dann aufwachen, wenn die Sachen kommen, die sie angehen); Q wie Question (eine Frage aufwerfen; nicht: die Befragung. Das ist Medien-Scheiße (das Wort »debile« kommt oft vor. Übersetzt mit: Blödheit). Vordringen bis zum Problem. Beispiel Gott. Pascal: seine Frage ist nicht, existiert Gott oder existiert Gott nicht, sondern, hat der, der an Gott glaubt, eine bessere Existenz als der, der nicht glaubt. Pascal denkt: ja, er hat. Oder Nietzsche: interessiert sich einen Scheißdreck, ob Gott tot ist oder nicht. Er sagt, wenn Gott tot ist, warum soll dann nicht auch der Mensch tot sein. Es geht um die Heraufkunft von etwas, das ein anderes ist, als der Mensch war. So dringen die Medien nie bis zum Problem. Hasse Diskussionsrunden. Oder: das Problem der Neuen Rechten. Ihr eigentlicher Impuls: die Parteiapparate aufzumischen, die Zentrale: Paris…Brüssel. Sie wollen regionalisieren. Ein Europa der Regionen, nicht der Nationen. Problem, das die Linke auch erreichen wird (und teils auch schon hat). R wie résistance (der Widerstand; nicht die Résistance der Besatzungsjahre nach 1940, sondern das Erschaffen – von Begriffen, von wissenschaftlichen Funktionen etc.; etwas finden/erfinden, heißt Widerstand leisten…dem allgegenwärtigen Unsinn, der im Umlauf ist. Dahinter der Widerstand gegen die Tatsache, Mensch zu sein. Überall wird das Leben ständig eingesperrt. Widerstand Kunst: jede Kunst befreit eine Lebenskraft. Es gäbe überhaupt keine Kunst sonst. Zur Scham: man schämt sich auch für andere. Für die Dummheit der andern. Antriebsimpuls. Die Werbung gibt sich heute als Konkurrenz der Kunst und der Philosophie. Warum nicht. Aber was für schwache Konzepte!) – Man sagt ja gern, »Kunst…Erlösung durch Kunst«, das sei ein deutsches Konzept; stimmt nicht; es ist durchaus französisch, nicht anders bei Jean-Luc Godard oder Agnes Varda. Man kann sogar sagen, Deleuze fügt die Philosophie eigentlich dem Konzept Kunst ein…»Echos erzeugen zwischen Begriff und Perzept«. S wie style (der Stil: da wären wir endlich, sagt Deleuze. Zuerst: Man sollte möglichst nichts über Linguistik wissen. Die Linguistik hat viel Schaden angerichtet…hat nichts zu tun mit Literatur. Linguistik: handelt vom System einer Sprache in ihrem Gleichgewicht. Was nicht in diesem Gleichgewicht ist, wird der Rede zugerechnet, parole. Der Künstler, der Autor dagegen weiß, dass eine künstlerische Sprache immer ein System sprengt; ein System im permanenten Ungleichgewicht ist. Für ihn kein prinzipieller Unterschied zwischen Sprache und Sprechen (langue und parole). Zwei Merkmale des Stils: Die Sprache einer Behandlung unterziehen, einer Behandlung, die alles mobilisiert. Zustandsveränderung; etwa Sprache zum Stottern bringen. Peguy: großer Stilist…Sätze von ihrer Mitte her wuchern lassen, durch eingefügte Parenthesen. »Man vergißt immer, dass man es – bei Peguy wie fast allen großen Künstlern – mit komplett Wahnsinnigen zu tun hat. Nie wieder wird einer schreiben wie Peguy«.Eine Behandlung also, eine umfassende, systematische, unheimliche. Keine Syntax-Bewahrer. Proust: »Alle Meisterwerke sind immer in einer Art Fremdsprache geschrieben. Ein Stilist ist einer, der in seiner Sprache eine Fremdsprache erschafft«. Und, zweiter Punkt: Die Sprache dabei an eine Grenze treiben, wo sie übergeht in andere Medien, etwa in Musik. Saum, der sie von der Musik trennt, bei anderen von der Malerei. Man produziert eine Art Musik. Zu Céline: die Leute sagen, er habe die gesprochene Sprache in das Schreiben eingeführt. Quatsch. Es war seine spezielle Schreibarbeit, die Arbeit am Stil, nix Rede. Er weiß genau, während man ihn dafür feiert, das ist noch nicht, was er will. Als sich alle ärgern über Mort à crédit, weil es anders ist als Voyage, weiß er trotzdem, das ist es noch nicht; erst mit Guignols Band wird er es haben…seine Musik…den Style). Dann T – und man staunt: (T wie Tennis; und er legt los: Björn Borg als der große Stilist, der das Tennis zum Massensport transformiert. McEnroe: Stilist des Aristokratischen; unnachahmliche Schläge. Aber Borg:…wie Jesus! Und er unterbricht sich: »nein, jetzt rede ich Unsinn«. Das ist auch so ein Merkmal, es geht nicht mit ihm durch, wenn ein Redegaul davon will; er kann sich bremsen. Außer Tennis dann noch: Fußball). U wie un (eins; er nimmt aber nicht die Zahl sondern un als die Vorsilbe von Universelle; um zusagen, dass aber nicht das Universelle, sondern Singularitäten der Stoff der Philosophie sind; Mannigfaltigkeiten und Ensembles. Kontemplation, Reflexion, Kommunikation als die 3 Universalien der Philosophie? Quatsch, alles drei tut jeder – ein Witz. Singularitäten wichtiger als Universalien. Die drei Universalien der Philosophie sollen sein Kontemplation, Reflexion, Kommunikation. »Alle drei sind ein Witz, wirklich grotesk, wenn man sie dem Philosophen anhängen will. Der Philosoph, in Kontemplation versunken, gut, alle Welt hat was zu lachen. Der Philosoph in Reflexion versunken, das ist nun nicht zum Lachen, aber noch dämlicher. Kein Mensch braucht einen Philosophen zum Nachdenken. Musiker, Maler, Mathematiker, sie reflektieren selbstverständlich, dauernd, das ist keine philosophische Spezialität, schon gar keine Universalie und die Kommunikation erst recht nicht. Alle kommunizieren, jeder. Die Kommunikation genügt sich selbst, als philosophische Universalie lächerlich. Habermas, zum Lachen. Der Philosoph erschafft Begriffe, er kommuniziert nicht. Auch die Kunst ist nicht kommunikativ, nicht reflexiv, ebenso wenig wie die Philosophie. Sie ist nicht kontemplativ, nicht reflexiv, nicht kommunikativ, sie ist schöpferisch , fertig«).
»Was ich will? Leute dazu bringen, sich an ihrer Einsamkeit zu erfreuen. Alles was sie hervorbringen werden, verdanken sie ihrer Einsamkeit. Sie rufen zwar nach Kommunikation, aber die Produktion ist einsam. Und zweitens: ich möchte Begriffe in Umlauf bringen; aber nicht, dass man sie nachbetet, sondern benutzt. Foucault, Deleuze: das sind Netzwerke, ja. Die deutsche Romantik: ein Netzwerk«. (Die Nouvelle Vague, hätte er hinzufügen können). »Wir sind Moleküle im molekularen Netzwerk. Wahrgenommen werden von unwahrnehmbaren Personen, das wäre das Ideal«. Aber, andererseits höchst individuell, »nur machen, was einem selbst als notwendig erscheint«. Er habe kein Buch geschrieben, das in jenem Moment für ihn nicht notwendig gewesen wäre.
Und immer wieder aufblitzend, nietzscheanisch, schlanke treffende Aphorismen: »Cézanne war es endlich gelungen, den Gegenstand zu zerbrechen; die Kubisten verschwenden ihre Zeit darauf, ihn wieder zusammenzukleben«. Überraschend, ja; als Zerbrecher des Gegenstands haben wir ja die Kubisten im Kopf. Man kann aber sehen, wovon er spricht: wie »der Gegenstand« beim späten Cézanne in übereinandergelegten durchsichtigen zarten Farbschichten tatsächlich verschwindet, während unser Hirn, hat man die kubistischen Prinzipien erst mal internalisiert, keine Probleme mit der sich selbst erneuernden Ganzheit des Gegenstands hat. Cézanne Revolutionär, Picasso Traditionalist.
Anders als bei Karl Kraus oder Adorno, wo das Aphoristische Arm in Arm mit seinem Halbbruder, dem Besserwisserischen, aufzutreten pflegt, sind solche Wendungen bei Deleuze frei vom Gestus der Angeberei; wie meist bei Nietzsche auch. Viele seiner Konzepte, auch hierin Nietzsche verwandt, sind aber nicht ins zeitgenössische Denken durchgedrungen, haben sich nicht »durchgesetzt«. Insbesondere sein Verdienst, zusammen mit Felix Guattari den Gegensatz von Human-Körper und maschinellem Körper aus dem psychoanalytisch-philosophischen Denken beseitigt zu haben, das Unbewußte begriffen zu haben als Wunschmaschine, ist kaum gebührend gewürdigt worden.
Ob ihn Nietzsches gelegentlicher Antisemitismus nicht störe, will Claire Parnet wissen. Nein, da ist kein Antisemitismus. Nietzsche findet/erfindet den Begriff der priesterlichen Macht. Den Priester selbst (die Idee Priester) hat aber das jüdische Volk erfunden; das wirft Nietzsche »den Juden« vor. Das Christentum hat die Juden darin beerbt und die Schuld-Konstruktion daraus übernommen. Ergebnis: die Traurigkeit der Religionen. Diese beklage er. Parnet: Ja, du klagst eigentlich dauernd. Deleuze: Schon. Die Linie der Klage geht über Kant bis zu Artaud: Schluß mit dem Gottesgericht. Aber Klage kann zur Freude führen, zur »Farbe«. In der Klage ist oft Freude verborgen.
Fehlen noch V wie Voyage (das Reisen; nicht so gern; Parnet: Du hast das Konzept des Nomadismus erfunden, aber du bleibst zu Hause, reist nicht. Deleuze: Beirut zu Fuß war interessant. Aber Nomaden? Reisen nicht. Sie bewegen sich ja, weil sie bleiben wollen, ihrer Erde verhaftet; ihrer Art des Daseins verhaftet; also da weg müssen, wo sie sind. Das Territorium wechseln, wenn die Weiden abgefressen sind. Das nächste Stück Land ist ihnen im Prinzip das gleiche Stück Land«). Bleiben X und Y, die Parnet überspringt: >X ist die Unbekannte; Y kann man nicht aussprechen<, sagt sie. Deleuze lacht. Aber davor war das >W<; da hat er (zuerst) gar nichts sagen wollen. >W gibt’s nicht<. Doch, insistiert sie, >Wittgenstein<. Gelegenheit zu einer großen Attacke: Wittgenstein, das ist Nichts; das ist reine Verwaltung. Wittgenstein, Heidegger, Habermas, Lacan…alles Schulen, Bürokratien, Machtkämpfe, Kämpfe bis aufs Messer; die richtige Linie, Breton, die Surrealisten, Ausschlüsse, Abrechnungen, alles furchtbar. Früher im Gespräch hatte Parnet ihn gefragt nach dem überall vorausgesagten >Tod der Philosophie<, >Tod der Literatur< etc. Alles Quatsch, hatte Deleuze geantwortet, es gibt keinen Tod der Philosophie, solange nicht etwas wirklich Gleichwertiges an ihre Stelle getreten ist; es gibt höchstens den Mord. >Den Film kann man vielleicht ermorden, aber die Philosophie? Eher nein<. Jetzt, an dieser späten Stelle, beim >W<, ergänzt er: >Ja, Wittgenstein; wenn etwas die Philosophie ermorden kann, dann die Wittgensteinianer<. Es gibt also Feinde. Das Ideal >Politik ohne Feinde< (mein Ideal) hat er nicht erreicht. Es ist tatsächlich schwer zu erreichen angesichts Merkelscher Bankensubvention und des übrigen schwarz-rot-grün-gelben Banditismus aller Sorten.Weiterer Dauerfeind von Deleuze: nach wie vor die Psychoanalyse. Die im Anti-Ödipus 1972 vorgetragene Kritik an Freuds Konzept vom Unbewußten (>das Unbewußte ist keine Theaterbühne, es ist eine Produktionsstätte, eine Fabrik<), die Kritik an der Ödipus-Konzeption und an der familialen Verengung der Welt auf den Papa-Mama-Auschnitt (>das Pferd im Traum des kleinen Hans ist kein Vatersymbol), wird hier, 1988, wiederholt mit unverminderter Verve. Wie in einem Dauerduell mit Freud (eine Art Hyper-Konkurrent) werden diese drei Kugeln immer noch mal abgefeuert; aber: welcher Psychoanalytiker heute bezieht >Alles< auf Papa/Mama, auf Ödipus oder klappert Träume der Patienten ab auf entsprechende Symbole auf der Freudschen Liste? Kein Schwein tut das. Nebenbei entgleitet ihm einmal der Satz: >Die Psychoanalyse hat sich ja ganz neu aufgestellt<. Dazu zu sprechen, wäre lohnender gewesen; aber dazu hatte er keine Lust mehr in diesem Rede-Vermächtnis. Zumal ein Punkt sicher bestehen bliebe: die Psychoanalyse als Schule. Schulen sollen nicht sein; kein freundliches Wort wird hier verloren über Lacan. Von den Zeitgenossen, als Nicht-Schulen-Begründern, bleibt allein Michel Foucault; ein Freund; von dem er sogar weiß, dass er ständig Bayreuth besuchte und mit Wagner sündigte, aber: >Das war geheim. Das ist geheim<, erfährt Claire Parnet (die das schon wusste); und nun auch wir. Keine Schulen, sondern Erfindungen, Singularitäten. Die Philosophie, die Literatur, die Künste, auch wenn jemand sie kaum oder gar nicht kennt: allein ihre Existenz ist eine große Bastion gegen die Dummheit.
Manches ist also darunter, das durchaus in einer >normalen< (also idiotischen) Fernsehunterhaltung hätte gesagt werden können; und das ist dann sogar der Charme, das Anrührende dieses Rede-Marathons. Man bekommt mit, wie er denkt, wie er denkend-fühlend lebt; einfacher und vielleicht auch genauer als in den Büchern. Das Sprechen (zu Claire Parnet und zur Kamera) bringt den Philosophen (Mann der Schrift), doch dazu, zu kommunizieren; freundlich zu kommunizieren, besonders da, wo er zögert, wo er sagt, was er nicht schon 1000 mal in Vorlesungen gesagt hat, wo er reagiert; wo die Schatten und Lichter seiner Wahrnehmung über sein Gesicht huschen; die Momente, wo er als seine eigene Widerlegung spricht. Wo er eben nicht spricht als >reiner Geist<, als Toter, wie sein Witz vom Anfang sagt, sondern als lebendiger Mund, als Gesicht, nur unzulänglich verborgen hinter seiner Brille, als Gesicht ohne Hut – den man liegen sieht hinten im Bild auf einem Stapel Papiere – als redendes Ensemble solcher Singularitäten, welches berührt durch komplexe Simplizität; zusammenströmend (unterm Buchstaben Z) in den Worten, >dass alle Kunst aus der Scham herrühre, Mensch zu sein<. Wiedergutmachungsarbeit am Irrsinn, den Menschen produzieren: er selber als Person zwar keine >Einheit<, aber doch von einer Art Gesamtheit. Nicht sehr weit weg vom Tod, aber mit noch einigen Plänen; einigen Geheimnissen, die noch offenbar werden sollen. Figur des Offenbarers, ohne Prophet zu sein; Verkünder selbstverständlicher Anti-Transzendenz. >Wir wollten uns immer begnügen mit den Gegebenheiten der Erde, der Menschen und ihrer Tätigkeiten<. Genau so würde man sprechen (wäre die Menschheit von 2009 halbwegs zurechnungsfähig). Eine schöne Pille also auch gegen das religiöse Gerede aller Lager und Sorten. Pille, gut zu lutschen, wenn gut dosiert; nicht die 7 ½ Stunden in einem Zug…
© K.T., Vortrag Weimar, Nietzsche-Kolleg, 16. 10. 09
Kürzere Fassung gedruckt in SPEX # 323 Nov/Dez. 2009
[1] Einige Monate vor seinem Tod 1995 hat Deleuze der Ausstrahlung einiger Passagen im TV aber doch zugestimmt.
[2] Die Lächerlichkeit von Cohn-Bendit, den Fußballer Mesut Özil als Erfolg von Rot-Grün zu feiern (damit man Belgrad und Afghanistan, die wirklichen Erfolge von Rot-Grün, freundlich übersieht).
***
Vergessen wir nicht – die Psychoanalyse.[1]
»Dem Menschenthiere ein Gedächtnis machen«: Zu Spaltungsvorgängen beim eurasiatischen Kulturtyp.
Ich beginne mit zwei Autoren, die zu diesem Transparent eindringliche Plädoyers gehalten haben: Klaus Heinrich und Jacques Derrida – von dessen gleichnamigem Büchlein die Überschrift zu diesem Symposium ja stammt, der sich aber auch explizit mit dem »Vergessen« überhaupt beschäftigt hat.Klaus Heinrich hat im Mai 2006 einen Vortrag gehalten im Literaturhaus Berlin; Titel: Festhalten an Freud. Klaus Heinrich, „Religionswissenschaftler“, ich sage das in Anführungszeichen, das war halt sein Fach in Berlin, er ist lange emeritiert, über 80 Jahre alt; einer jener, die immer versucht haben, vom Denken der alten Griechen bis hin zu Freud das Denken als geschichtliches zu begreifen mit der Frage, was ist das Bewusstsein, was ist das Unbewußte, was ist die Geschichte und wie bewahrt sich etwas auf. Er leitet das so ein:
»“Festhalten an Freud“ – ein Titel wie dieser bedarf der Erläuterung, zumal in einem Jubiläumsjahr, in dem sich viele, kaum dass er hochgerufen ist, an dem verehrten Ahn festhalten werden. Aber halten sie auch an ihm fest? – Festhalten hat einen apologetischen Zug, und in der Tat: Hirnforschung, Traumforschung, Verhaltensforschung scheinen über Freud hinweggegangen, seine Spekulationen über die Frühzeit des Menschengeschlechts nurmehr ein Exempel spätaufklärerischer Mythenbildung zu sein, Soziologen konstatieren das Ende seiner seismischen Wirksamkeit, er wird heute vorzugsweise aus historischem oder literarischem Interesse gelesen, und selbst in seiner eigenen Disziplin, der Psychoanalyse, haben die Schulen ihn und sein therapeutisches Instrumentarium mit Ehrerbietung hinter sich gelassen. Natürlich bauen sie Alle auf ihm auf, und gerade die Neuerer unter seinen Nachfolgern, Kleinianer, Lacaner, große Einzelgänger wie Bion oder Winnicott, haben daraus nie ein Hehl gemacht. Aber eine um die Anerkennung ihrer therapeutischen Erfolge kämpfende, die kassenärztliche Zulassung immer wieder neu erstreitende Berufsorganisation hat die Trieblehre ihres Großvaters längst als Ballast über Bord geworfen – ein Relikt des vorvergangenen Jahrhunderts, das in zeitgenössische theoretische Konzepte zu übersetzen müßig erscheint. Und nicht minder müßig scheint es zu sein, das individuelle und das kollektive Seelenleben, nun gar die „archaische Erbschaft“ (Freuds Begriff!) und die aktuelle Seelenlandschaft – also die frühe und die eigene traumatische Realität – miteinander in eine reale Wechselbeziehung setzen zu wollen. Aber genau das, wir erinnern uns, hat Freud getan«.[2]Erinnern wir uns? Zunächst einmal erinnert Klaus Heinrich in diesem kurzen Summary zu Freuds schwindender Wirkungsgeschichte daran, dass heutige Analytiker, die um die kassenärztliche Zulassung kämpfen, Freudsche Basics wie die »Erbschaft der Trieblehre« über Bord geworfen hätten. Ich erinnere mich an die Äußerung des amerikanisch-österreichischen Analytikers Fredric Wyatt in einer öffentlichen Diskussion schon Anfang der 70er:»Was das Unbewusste ist, brauchen wir als Analytiker nicht zu wissen. Die Arbeit kommt ohne das aus«. Kurz und bündig.
»Daß die psychische Realität, von der wir hier reden, durch nicht aufhebbare Ambivalenzen und, sobald wir diese aufzudecken meinen, durch die “Überdeterminiertheit“ aller seelischen Regungen bestimmt ist, macht monokausale Ableitungen ebenso stumpf wie die Festlegung auf einen Identität behauptenden, mit Affirmation und Negation operierenden Begriffsgebrauch. Wenn psychische Realität nicht weniger real ist als die vermeintlich objektive (das hatte Freud zuerst an den Fällen phantasmatischer Verführung mit allen Folgen phantasierten sexuellen Missbrauchs erkannt), ist kein scharfer Schnitt mehr zu machen zwischen realistischer und wahnhafter Deutung, jedenfalls kein selbst objektivierbarer Schnitt, der mir den eigenen Kampf gegen den Wahn erspart; kann die Flucht vor dem Wahn in einem selbst wahnhaften Realismus münden. Unter dem Namen „Positivismus“ war das eine der großen Gefährdungen der sich zuerst durch Ethnologisierung des NS (eine heute unbegreiflich-fremde, ebenso brutale wie lächerliche Welt), zuletzt durch Historisierung des NS (eine gefährlich-spannende, indes versunkene Welt) gegen dessen selbstzerstörerische Verführung im Nachhinein noch abschottenden – erst im Nachhinein sich abschottenden – deutschen Nachkriegsgesellschaft. Ich habe damit das Stichwort genannt, das erklären soll, warum mir „festhalten“ an dem Aufklärer Freud nicht als eine private, sondern öffentliche Forderung erschienen ist: Selbstzerstörung.
Selbstzerstörung war die Realität, mit der meine Generation, die mit Kriegsende zu studieren begann, aufgewachsen ist. Die Folgerung lag auf der Hand: Wissenschaften und Philosophie, die das nicht zum Thema machten, hatten den Nachkriegsauftrag der Universität verfehlt. Ich habe die folgende, durchaus appellativ gemeinte Formulierung oft gebraucht, um die in meinen Augen vornehmste Aufgabe der Universität zu bezeichnen, und ich muß das hier noch einmal tun, weil sie den Kern unserer damaligen Erwartungen – übrigens meiner heutigen auch – mit Deutlichkeit benennt: „der Gesellschaft ein Bewusstsein ihrer selbst zu geben“. Das hieß damals nichts anderes, als daß die Universität sie über ihre eigenen selbstzerstörerischen Prozesse aufzuklären habe«.[3]
Schön. Nicht anders ist das auch mir, 20 Jahre jünger als Klaus Heinrich, vom ersten Universitätsmoment an, also Herbst 1962, als ihre selbstverständliche Aufgabe erschienen. Auf der Universität war ich nicht in erster Linie, um als »Philologe«, Spezialist der Textauslegung, als Germanist & Anglist weiter ausgebildet zu werden. Im sog. »Interpretieren« von Texten – Gedichten, Dramen, Romanen – fanden »wir« (als literarisch infizierte Studenten) uns sowieso unschlagbar; den beschlipsten Professoren, Literatur-Bürokraten, überlegen. Aber: »Was ist mit der Gesellschaft«? »Was ist und was war mit der Nazi-Generation«? Für solche Rede hätten sich unsere Ohren weit geöffnet. Genau dafür aber öffnete sich kein universitärer Mund.Klaus Heinrichs Forderung, mit fremdem »aufklärerischem« Blick auf sich selbst zu sehen – so der Kern seines Plädoyers in Anlehnung an Kant und Freud – ist bis heute von kaum einer Institution eingelöst. Kritische Reflexion der eigenen Tätigkeit als einer gesellschaftlichen in der Universität gibt es nur als Privatsache einzelner Professoren. Lediglich in der Psychoanalyse unterliegt die eigene Tätigkeit – in den verschiedenen Formen der Supervision – einer institutionalisierten selbstreflexiven Arbeit.
In seiner Einleitung zu seinem Buch-Essay Dem Archiv verschrieben sagt Jacques Derrida zum Komplex des Historischen:»Niemals verzichtet man darauf – dies ist das Unbewußte selbst –, sich eine Macht über das Dokument, über seinen Besitz, seine Zurückhaltung oder seine Auslegung anzueignen. Doch wem kommt in letzter Instanz die Autorität über die Institution des Archivs zu? Wie wird man den Bezügen zwischen der Gedächtnisstütze, dem Anzeichen, dem Beweis und dem Zeugnis gerecht? Denken wir an die Auseinandersetzungen um die ganzen „Revisionismen“. Denken wir an die Erschütterungen der Geschichtsschreibung, an die technischen Umwälzungen in der Konstitution und Behandlung so vieler „Dossiers“. Muß man nicht damit beginnen, das Archiv von dem zu unterscheiden, worauf es allzu häufig reduziert wird, namentlich die Erfahrung des Gedächtnisses und die Rückkehr zum Ursprung, aber auch das Archaische und das Archäologische, die Erinnerung oder die Ausgrabung, kurz, die Suche nach der verlorenen Zeit?«[4]
Das Archiv als »Errichtung einer Instanz und eines Ortes von Autorität«, fährt Derrida fort, oft genug ein staatliches Gebilde, patriarchal oder fraternal organisiert, ergäbe sich dabei »niemals im Verlauf eines Akts intuitiver Anamnese«, welche die Ursprünglichkeit eines Ereignisses wiederaufleben ließe. D. h., Erinnerung, Gedächtnis allein, welcher Art auch immer, reichen nicht hin, so etwas wie das Archiv zu konstituieren. Derrida entwickelt seine Überlegungen zum Archiv in Auseinandersetzung mit Yerushalmi, dem amerikanischen Historiker des Judentums; gespannt auf eine Diskussion der Frage, was ist Wissenschaft und was ist Jüdisch-Sein; »jewishness«, wie das bei Yerushalmi heißt. Beide sehen den Begriff des Archivs selber historisch als etwas Jüdisches, Wissenschaft und jewishness seien nicht voneinander zu trennen; die Institution des Archivs nicht von den Aufzeichnungsweisen und Wahrnehmungsweisen des Judentums. Beginnend in der Auseinandersetzung mit der Frage, ob Moses von den Juden umgebracht worden sei oder ob dieser Mord nur ein geplanter, ein virtueller Mord war; was, wie Derrida (mit Freud und der Psychoanalyse) meint, keinen Unterschied macht für die Konstruktion des Archivs, das aus einer solchen Gewalttat am Anfang unserer Geschichtsschreibung hervorgeht. Gewaltprozesse am Anfang »unserer« Geschichte, von denen wir alle etwas wissen oder ahnen, mit denen wir uns aber selten bewusst, in einer bewussten Arbeitsform, auseinandersetzen.
Das Archiv ist so immer »faktisch« und »virtuell« zugleich, woraus mit Derrida folgt, »dass die Interpretation des Archivs (hier zum Beispiel das Buch von Yerushalmi) ihren Gegenstand, ein gegebenes Erbe nämlich, nur erhellen, lesen, interpretieren, einrichten kann, indem sie sich darin einschreibt, das heißt, indem sie es öffnet und es ausreichend erweitert, um mit vollem Recht darin Platz zu nehmen. Es gibt kein Meta-Archiv. (…) Der Archivar produziert Archivarisches, deshalb wird das Archiv niemals abgeschlossen sein. Es ist von der Zukunft her geöffnet« – ganz ähnlich hörten wir es vorhin von Bion – es geht hier »um die Zukunft und um das Archiv als einer irreduziblen Erfahrung der Zukunft«.[5] Derrida spricht also, wie Bion, von einer Erfahrung der Zukunft, einem memoir, einer Erinnerung an Zukünftiges. Das heißt, von verschiedenen Seiten her, Geschichte ist in keiner Weise abgeschlossen, es gibt nicht einfach »das Erinnerte«ۚ; mit jedem Eintritt in das Archiv, mit jeder Belebung, fügen wir etwas Neues hinzu und erweitern es; ganz ähnlich wie Jean-Luc Godard es formuliert in seinen Histoire(s) du cinéma: »Die Geschichte ist nie abgeschlossen. Das Vergangene ist nicht einmal vergangen«. Genauso ist die »Zukunft« in verschiedenen Gestalten immer schon da. Daß wir die Zeiten fiktiv linear unterteilen, ist eine Gewohnheit des westlich-positivistischen Denkens, auf deren Gründe ich noch zurückkomme. Die Vergangenheit hinten, die Zukunft vorn, die Gegenwart »jetzt«, eine Konstruktion, die für alle etwas versierteren Leute unsinnig ist; für die meisten Künstler, für fast alle Autoren liegen alle Zeiten gleichzeitig vor; es kommt darauf an, in welche Beziehung wir uns dazu setzen. Schon von daher sind alle Leute, die für die »Abgeschlossenheit« von etwas Vergangenem plädieren, grundsätzlich »suspekt«. Was haben sie zu verbergen?
Von Klaus Heinrich und Derrida möchte ich eine Brücke schlagen zurück zu einem dritten Menschen, der sich intensiv mit der menschlichen Gedächtnisbildung beschäftigt hat; zu einem prä-psychoanalytischen Autor, aber nicht ganz, seine Lebenszeit fällt in die Freuds; ist aber von kürzerer Dauer; Friedrich Nietzsche, von dem mir immer ein Zitat-Bruchstück im Kopf herumhing, das lautet: »Erinnert wird nur, was nicht aufhört, weh zu tun«. Nietzsche stellt einen Kausalzusammenhang her zwischen bestimmten Formen von Gewaltausübung und Gedächtnisbildung. Das berührte mich immer und berührt mich weiter als mein eigenes und auch mein generationelles Problem, da ich, geboren 1942 und zum historischen Denken gekommen als Adoleszent in den 50er Jahren, es unerlässlich fand, irgendwie herauszubekommen, wie das ging: Eltern zu haben, die einerseits ihr eigenes Arbeitsleben ganz und gar der Aufgabe unterordneten, ihre sechs Kinder nicht nur einigermaßen großzukriegen, sondern mit der bestmöglichen Bildung auszustatten, dabei relativ mittellos, Kleinbeamtenhaushalt, und andererseits völlig ungerührt zu sein im Angesicht der deutschen Nazi-Verbrechen, die für sie keine waren: also in Fortsetzung ihres im Lauf der 30er Jahre ganz selbstverständlich erworbenen Antisemitismus nicht mit der Wimper zu zucken bei sechs Millionen umgebrachter Juden; von ermordeten russischen Zivilisten zu schweigen.»Der Russe« stand bei ihnen – den heimatvertriebenen Ostpreußen – sowieso noch über »dem Juden« als Verbrecher; bzw. hatte der Nazidreh, »Judentum« mit »Bolschewismus« gleichzusetzen, bei ihnen voll durchgeschlagen. Hierhin reichte kein Mitleid und auch sonst kein menschliches Gefühl, außer kalter Ablehnung und »Wut« über die »verlorene Heimat«. Wut, die sich allerdings auch den Kindern gegenüber jederzeit explosiv manifestieren konnte, wenn diese in den Augen des Vaters nicht richtig »spurten« und also den Choleriker in ihm ans Handwerk riefen. Aufgewachsen unter gespaltenen Irren also. Ich habe daraus einmal zugespitzt formuliert, dass es mir rätselhaft sei, warum nicht alle Jugendlichen meiner Generation Psychoanalytiker geworden seien. Für die, die sich mit solchen Eltern auseinandersetzten, führte kein Weg an Freud vorbei.
Das Nietzsche-Zitat habe ich mir vor einiger Zeit noch mal genauer angesehen. Da steht ja eine Menge mehr als dieser eine scharfe Gedanke.Nietzsche, Zur Genealogie der Moral:
„Wie macht man dem Menschen-Thiere ein Gedächtnis? Wie prägt man diesem teils stumpfen, theils faseligen Augenblicks-Verstande, dieser leibhaftigen Vergesslichkeit Etwas so ein, dass es gegenwärtig bleibt?“ … Dies uralte Problem ist, wie man denken kann, nicht gerade mit zarten Antworten und Mitteln gelöst worden; vielleicht ist sogar nichts furchtbarer und unheimlicher an der ganzen Vorgeschichte des Menschen, als seine Mnemotechnik. „Man brennt etwas ein, damit es im Gedächtniß bleibt: nur was nicht aufhört, weh zu thun, bleibt im Gedächtnis“ – das ist ein Hauptsatz aus der allerältesten (leider auch allerlängsten) Psychologie auf Erden.[6] Man möchte selbst sagen, dass es überall, wo es jetzt noch auf Erden Feierlichkeit, Ernst, Geheimnis, düstere Farben im Leben von Mensch und Volk gibt, Etwas von der Schrecklichkeit nachwirkt, mit der ehemals überall auf Erden versprochen, verpfändet, gelobt worden ist: die Vergangenheit, die längste, tiefste, härteste Vergangenheit, haucht uns an und quillt in uns herauf, wenn wir „ernst“ werden. Es gieng niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nöthig hielt, sich ein Gedächtnis zu machen; die schauerlichsten Opfer und Pfänder (wohin die Erstlingsopfer gehören), die widerlichsten Verstümmelungen (zum Beispiel die Castrationen), die grausamsten Ritualformen aller religiösen Culte (und alle Religionen sind auf dem untersten Grunde Systeme von Grausamkeiten) – alles Das hat in jenem Instinkte seinen Ursprung, welcher im Schmerz das mächtigste Hülfsmittel der Mnemotechnik errieth«.
Bei Freud gibt es diesen Punkt ja auch: Einprägen durch Schmerz; manche Menschen werden nicht aus dem Lust-, sondern aus dem Schmerzprinzip geboren; so habe ich das in Männerphantasien für den »soldatischen Mann« formuliert, Geburt aus dem Schmerzprinzip. Aber weiter Nietzsche:
»Je schlechter die Menschheit „bei Gedächtnis“ war, umso furchtbarer ist immer der Aspekt ihrer Bräuche; die Härte der Strafgesetze giebt in Sonderheit einen Maßstab dafür ab, wie viel Mühe sie hatte, gegen die Vergesslichkeit und ein paar primitive Erfordernisse des socialen Zusammenlebens diesen Augenblicks-Sklaven des Affekts und der Begierden gegenwärtig zu erhalten. Wir Deutschen betrachten uns gewiss nicht als ein besonders grausames und hartherziges Volk, noch weniger als besonders leichtfertig und in-den-Tag-hineinleberisch; aber man sehe nur unsere alten Strafordnungen an, um dahinter zu kommen, was es auf Erden für Mühe hat, ein „Volk von Denkern“ heranzuzüchten (will sagen: das Volk Europa’s unter dem auch heute noch das Maximum von Zutrauen, Ernst, Geschmacklosigkeit und Sachlichkeit zu finden ist (…) Diese Deutschen haben sich mit furchtbaren Mitteln ein Gedächtnis gemacht, um über ihre pöbelhaften Grund-Instinkte und deren brutale Plumpheit Herr zu werden: man denke an die alten deutschen Strafen, zum Beispiel an das Steinigen (‑ schon die Sage lässt den Mühlstein auf das Haupt des Schuldigen fallen), das Rädern (die eigenste Erfindung und Spezialität des deutschen Genius im Reich der Strafe!), das Werfen mit dem Pfahle, das Zerreißen- oder Zertretenlassen durch Pferde (das „Vierteilen“), das Sieden des Verbrechers in Öl oder Wein (noch im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert), das beliebte Schinden („Riemenschneiden“), das Herausschneiden des Fleisches aus der Brust; auch wohl dass man den Übeltäter mit Honig bestrich und bei brennender Sonne den Fliegen überließ. Mit Hülfe solcher Bilder und Vorgänge behält man endlich fünf, sechs “ich will nicht“ im Gedächtnisse, in Bezug auf welche man sein Versprechen gegeben hat, um unter den Vortheilen der Societät zu leben – und wirklich! Mit Hilfe dieser Art von Gedächtnis kam man endlich „zur Vernunft“! – Ah, die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese ganze düstere Sache, welche Nachdenken heißt, alle diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen: wie theuer haben sie sich bezahlt gemacht! Wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller „guten Dinge“!…«
Wow, was für ein Abschnitt. Nietzsche, heute ja eher wenig gelesen, versprüht Formulierungen, wie sie sich bei Freud ca. 50 Jahre später, im Unbehagen in der Kultur, Freuds zivilisationskritischstem Schreiben finden (wozu Freud die Erfahrung des 1. Weltkriegs brauchte). Die europäischen Menschen bei Nietzsche heißen Augenblicks-Sklaven des Affekts und der Begierde; mit Mühe und Not haben sie einige primitive Erfordernisse des socialen Zusammenlebens erreicht dadurch, dass sie auf gewohnheitsmäßiges Viertheilen verzichten unter dem Ausruf ich will nicht!: nämlich in Wein gesotten werden oder in Öl – nachdem sie eben dies oft genug vollbracht und aus solcher Wiederholung ein Gedächtnis sich gebildet haben. Die schärfste, die »zynischste« Formulierung, die sich denken lässt, wie »Mensch«, zumal der deutsche, zu »Gedächtnis« kam: nach unendlicher Wiederholung von Gewalttaten zum endlichen Ausruf: „ich will nicht (gevierteilt werden!)“. Ah, endlich die Vernunft.
Eine Theorie der Gedächtnisbildung allerdings, nach der die Nazischlächter, die sich »nach dem Krieg« an Nichts erinnerten, über ein ganz besonders gutes Gedächtnis hätten verfügen können; genug »Blut und Grausen auf dem Grund aller „guten Dinge“« hatten sie ja angerichtet und gesehen. Oder hatte gerade dies ihnen geholfen, bei der »Herrschaft über die Affekte« endlich angekommen zu sein: Befriedet und schließlich geläutert durch Dauermorden, ein deutsch-österreichischer Sonderweg vor der Geschichte; mit dem besonderen Resultat, sich an Nichts zu erinnern außer an die eigene Unschuld.
Vielleicht stimmt sie doch nicht so ganz, Nietzsches grundlegende Theorie der Gedächtnisbildung durch Schmerz; oder wir haben es mit einer besonders ausgefuchsten Spezies versierter »Lügner« oder Versteller zu tun bei all jenen Nazi-Tätern und Mit-Tätern, die so standhaft schwiegen zu ihren Lebenstätigkeiten in Zeiten der (grade eben erst verschwundenen) »Schreckensherrschaft«. Vielleicht, weil es für sie keine solche war? Was ist mit den Gedächtnissen all der »Carusos«, von denen wir wissen oder auch immer noch nichts wissen;[7] Was ist mit dem Satz, der hier schon mehrfach aufgetaucht ist: »Wir haben es dauernd gewußt, aber nicht wissen wollen«; das Wissen nicht zugelassen. Die Frage, wie das denn funktioniert, die hier mehrmals gestellt worden ist; auf die hoffe ich doch am Ende des Vortrags wenigstens eine Teilantwort geben zu können.
In puncto Schmerzprinzip gibt es, ähnlich wie Nietzsche, nur schlechter geschrieben, ein Buch aus dem letzten Jahr, Christoph Türcke, Philosophie des Traums. Türcke sind in Freuds Traumdeutung zwei Begriffe aufgefallen, Verschiebung und Verdichtung. Freud sagt dort, es gibt keine Traumbildung ohne diese beiden Mechanismen; Sie kennen das alle, die Verschiebung auf andere Orte und Personen; die Verdichtung, mehrere Zeiten übereinandergelegt und mehrere Personen verdichtet in einer einzigen, wie in Galtons Mischfotografien, etc. Türcke wendet dies nun an auf die Frühgeschichte der Menschen, insbesondere auf die Situation des Opfers, Genese des Menschenopfers. Das frühe Menschenopfer und seine Ablösung durch das Tieropfer steht bei Türcke im Zentrum all seiner Überlegungen zur frühen Menschheitsgeschichte.»Die Bedeutung des Opfers für die frühe Menschheit ist kaum zu überschätzen. Sobald altsteinzeitliche Siedlungsplätze die geordnete Gestalt von Stätten annehmen, sind sie um ein Zentrum gruppiert: einen Berggipfel, einen Stein, einen Pfahl, einen Herd, Gräber. Zentrum aber heißt Opferzentrum, und Begräbnis ist von Opferung anfangs nicht trennscharf geschieden. Und wo wir mythologisch auf die Spuren früher Menschheit stoßen, also auf (61) alte Erzählschichten, da ist das Opfer entweder die zentrale Handlung selbst oder aber die treibende Kraft der Erzählung. Das griechische Verb rezein ist das Wortgedächtnis für diesen Sachverhalt. Es bedeutet sowohl „Opfer darbringen“ als auch generell „handeln, tätig sein“ und drückt damit aus, dass Opfern der Inbegriff menschlichen Handelns, die menschenspezifische Tätigkeit schlechthin ist. Töten – das tun auch die Tiere, gelegentlich auch ihresgleichen. Aber rituell töten, in feierlicher Versammlung an einem bestimmten Ort nach einem festgelegten Schema: das ist ein spezifisches, exklusives Merkmal des Menschen.Opfer gehen an die Substanz. Man schlachtet nicht Frösche und Schnecken, sondern das Teuerste, was man hat: Menschen, später auch Großtiere. So etwas tut man nicht aus Spaß, sondern nur, wenn man sich anders nicht zu helfen weiß. Offenkundig sucht man sich damit Entlastung zu verschaffen. Nur, was ist am Opfer entlastend? Es wiederholt doch Grauen und Leiden, es tut dasjenige, wovon es entlasten will. Das ist absurd. Das Opfer lässt sich überhaupt nicht verstehen, wenn nicht vom traumatischen Wiederholungszwang aus. Es ist der in eine Form gebrachte Wiederholungszwang. Um den Naturschrecken los zu werden, von dem sie befallen wurde, befällt sich die Hominidenhorde noch einmal selbst. Von den lebendigen Wesen, an denen sie am meisten hängt, wählt sie einige aus und schlachtet sie gemeinsam. So spielt sie den Naturschrecken herunter, indem sie ihn selbst veranstaltet, einübt, in eigene Regie nimmt und ihm dabei jene festen Regeln gibt, die wir rituell nennen. (…) Ritual und Opferritual sind anfangs identisch. Alle Rituale sind Abkömmlinge des Opferrituals«[8]. (62)
Hier dreht sich alles um die Wiederholung. Gedächtnis ist entstanden aus wiederholten Katastrophen, die Türcke »Naturschrecken« nennt. Das Gedächtnis seiner Frühmenschen kommt dem Naturschrecken zuvor und veranstaltet ihn lieber selbst, um ihn so zu »beherrschen«. Da das etwas widersinnig ist, wird der Vorgang von Türcke zur Zwangshandlung erklärt; den Einflüssen »vernünftigen Denkens« also enthoben. Traumatischer Wiederholungszwang als Schlüsselbegriff:
>In den Anfängen der Ritualbildung sind nun aber bereits jene elementaren Mechanismen am Werk, die Freud erst für die Traumbildung veranschlagt hat. Dass der traumatische Wiederholungszwang den Schrecken in sein Gegenteil verkehrt, wurde bereits gezeigt. Er ist die Umkehrung schlechthin: Gutheißung des Schrecklichen. Ritualisieren aber kann sich diese Gutheißung immer nur an einem bestimmten Ort. Zum Ritual gehört der abgegrenzte Raum, in dem es ungestört ablaufen kann. Das muß ein befriedeter Raum sein. Die (62) Horde muß einmütig in ihn eintreten und einvernehmlich das Ritual vollziehen, sonst ist es nicht rta. Auf den Boden dieser Einmütigkeit muß sie den Naturschrecken gleichsam herunterbrechen, ihn dort als Konzentrat seiner selbst vollziehen. Und dabei geschieht zweierlei: Seine vielfältigen Erscheinungsweisen werden im rituellen Raum zu einer einzigen verdichtet. Und er wird von seinen vielfältigen Erscheinungsorten in den rituellen Raum verschoben.
Da sind sie: Verdichtung und Verschiebung. Ohne sie kommt kein Traum zustande, sagte Freud. Nun lässt sich hinzufügen: ohne sie kommt es nicht einmal zur Konstitution des rituellen Raums. Und erst hier zeigt sich, wie sie zusammengehören. Sie hängen in einem dritten zusammen: der Umkehrung. Das gibt der Traum nicht mehr direkt zu erkennen. Dazu ist er schon zu sehr Sekundärphänomen. Er zeigt, wie Verdichtung und Verschiebung funktionieren, aber er offenbart nicht mehr den Kraftakt der Umkehrung, der sie einst in Gang gesetzt hat. (…)
Dabei hatte Freud emotional durchaus recht, die Umkehrung als dunkle Stelle zu empfinden, setzt sie doch am Furchtbarsten an: am Schrecken. Sie ist gleichsam der Urstrudel des Grauens – und zugleich der Angelpunkt der Menschwerdung: der erste Schimmer der Humanität. Erst im Erregungsstrudel der Umkehrung kommt es zu Verdichtung und Verschiebung. Sie sind Manifestationen der Umkehrung des Schreckens in sein Gegenteil durch Wiederholung. Durch Verdichtung in eine repräsentative Form wird der Schrecken überhaupt erst greifbar. Durch Verschiebung in einen rituellen, störungsfreien Raum wird er berechenbar. Verdichtung und Verschiebung sind die beiden elementaren Umkehrungsmaßnahmen, die den Schrecken durch unablässige Wiederholung in einen rituellen Raum hinein zu konzentrieren und darin dingfest zu machen versuchen«.
Die unablässige Wiederholung von Gewaltakten steht auch hier am Anfang unserer Kultur; am Anfang der Gedächtnisbildung und am Anfang des religiösen Rituals. Eine Tradition männlichen Denkens will das so; in die ja auch Freud selber zu einem Teil gehört mit seiner Theorie des Urhordenmords. Man wird gleich sehen, was das Fehlen der Frauen in solchen Konstruktionen bedeutet. Ich mache dazu einen Sprung in einen anderen Kontext:
In einem schönen Buch zur Psychoanalyse der Musik gibt Sebastian Leikert einen Abriß der Bedeutung des Hörens für das Kind im pränatalen Stadium. Die erste Besonderheit der Musik liegt für Leikert darin, dass sie sich, anders als die Wörter, »nicht auf gesehene Objekte (Objektvorstellungen), sondern auf erlebte Körperspannungen bezieht«. Der Fötus lebt in einer akustischen Welt. Die erste Umgrenzung des Selbstgefühls im Mutterleib ist eine »Lauthülle«. Sie gibt, noch vor der Erfahrung der Haut, dem Fötus ein erstes Konsistenzgefühl. »Ab dem vierten Monat der Schwangerschaft ist das Gehör als erstes Sinnesorgan voll ausgebildet und spielt eine wichtige Rolle in der Beziehung von Fötus und Mutter. In der Stimme gewinnt die Mutter für das ungeborene Kind die erste fassliche Gestalt, die Mutter ist für das Kind zunächst die Stimme«[9]. Das Ungeborene entwickelt eine Beziehung zu dieser Stimme. »Zudem ist der auditive Kanal mit dem Körpertonus direkt verbunden. Das Gehör ist als Schaltstelle für die Muster der Innervation des Körpers verantwortlich, bestimmte Frequenzen sind für die Aktivierung der Hirnrinde und damit für den Körpertonus verantwortlich. Sowohl die psychische Aktivität als auch die Integration des Körpererlebens sind also mit der auditiven Beziehung eng verbunden«.
Der Fötus nimmt akustisch nicht nur die Stimme der Mutter wahr, er hört auch ihre Körpergeräusche, Darm, Pulsschlag, ihren Atemrhythmus, ihre Körperbewegung, die Rhythmik ihres Ganges. Die verschiedenen Geräusche im Mutterleib können 85 Dezibel erreichen, das ist etwa städtischer Straßenlärm. In einem späteren Schritt überträgt Leikert das Verhältnis des Fötus zur Stimme der Mutter auf die Stimme des Analytikers in der Analyse. Die Analyse sieht er primär akustisch basiert; der Halt des Analysanden in der Analyse ist angelehnt an den Halt, den der Fötus im Mutterleib in der Stimme der Mutter hat; in der Analyse ist es die Stimme des Analytikers, die diese tragende Funktion übernimmt (das nur nebenbei).
Psychophysiologisch gesprochen: der auditive Kanal startet den Körpertonus; d. h., die Bewegungen des Babies im Fruchtwasser werden ausgelöst durch akustische Signale. Damit starten die frühen psychischen Prozesse, die Prozesse der frühen Wahrnehmungstätigkeit des Fötus übers Ohr. Leikert sieht darin die ersten Rudimente dessen, was später, weit nach der Geburt, »Objektbeziehung« heißen wird; die Stimme der Mutter ist die erste Repräsentanz dieses Objekts.
Damit ist ein zentraler Einwand formuliert gegen die Theorien der Kultur- bzw. Gedächtnisbildung aus traumatischen Wiederholungszwängen bzw. aus Gewaltvorgängen verschiedener Art. Männliches Theorie-Denken überspringt nach wie vor gerne die tatsächlichen Vorgänge der Menschwerdung, an erster Stelle die Vorgänge im Mutterleib und die der Geburt. Dabei liegt es auf der Hand, dass Veranstaltungen wie die von Türcke beschriebenen Opferrituale erst passieren können, wenn das Kind nicht nur geboren, sondern ein wenig größer geworden ist; und dieses Stadium könnte es (ۚ»der Mensch«) nie erreicht haben ohne den primären Schutz, den die Gruppe um die gebärende Mutter gewährt. Ohne den weiteren Schutz, den das heranwachsende Kind erfährt; ohne diesen Schutz, d. h. ohne die organisierte Aussperrung von Gewaltprozessen, (die im Übrigen die Wirklichkeit dominieren mögen), gäbe es uns alle hier überhaupt nicht. Die »Menschheit« wäre schlicht nicht existent. Frühe psychische Prozesse starten im Mutterleib; dazu gehören die Gedächtnisprozesse. Sie entwickeln sich weiter im zivilen Schutzraum des frühen Infant-Seins, in dem das Kind eben nicht umgebracht (geviertheilt, in Öl gesotten, in Riemen geschnitten oder dem Großen Gott geopfert wird). Dies ist eine Fundierung der »Menschwerdung«, die zweifelsfrei bis in früheste Menschheitszeiten zurückverlegt werden kann, ohne projektiv zu sein. Genau hier ist »der erste Schimmer der Humanität« zu entdecken, den Türcke (ausgerechnet) im Opfervorgang verorten will. Ums Opfer herum gibt es eine Menge Spekulationen, wie auch um Urhorden, frühe Götter, etc., bitte: freie Fahrt. Die Mutterleibsgeräusche dagegen sind eine Tatsache auch der allerfrühesten Hominidenfrauen. Jeder Fötus »erinnert« zuerst die Verdauungsgeräusche der Mutter, ihren Herzschlag und die Töne, die ihre Kehle von sich gibt. Das übrige sind Männerphantasien.
Erinnert wird, was nicht aufhört weh zu tun? Kommt vor. Erinnert wird aber auch, was nicht aufhört, gut zu tun.
Was sagt – nächster Sprung – die neuere Hirnforschung zu den in Frage stehenden neurophysiologischen Prozessen und insbesondere zur Gedächtnisbildung. Ich habe hier das Buch des Bremer Neurobiologen Gerhard Roth in der Hand: Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unsere Verhalten steuert; das ist ein umfassendes Kompendium der neueren Forschung. Für uns besonders interessant: im 7. Kapitel dieses Buchs unternimmt Roth eine weitgehende Rehabilitierung Freuds gegenüber früheren Angriffen der Hirnforschung auf die Psychoanalyse, wie sie bis in die 90er Jahre des 20. Jhds. üblich waren.Mehrere spekulative Grundannahmen Freuds sieht Roth durch die heutige Hirnforschung bestätigt. Besonders die Annahme unbewußter determinierender Prozesse sieht er als neurobiologisch erwiesen an.
»Schließlich haben die Neurowissenschaften zusammen mit der Psychiatrie und der Entwicklungspsychologie begonnen, die Folgen frühkindlicher traumatischer Ereignisse wie Störungen der Mutter-Kind-Beziehung, des sexuellen Mißbrauchs und anderer stark belastender Geschehnisse auf neuronaler Ebene nachzuweisen (…) All dies erfüllt schon jetzt die Forderungen, die Freud nannte, nämlich eine „Lokalisation der seelischen Vorgänge“ zu erreichen und „den anatomischen Ort des Systems Bw, der bewußten Seelentätigkeit, in der Hirnrinde zu erkennen und die unbewußten Vorgänge in die subkortikalen Hirnpartien zu versetzen…“«[10] (433)
Es folgt eine Auflistung der vielfältigen Methoden, mit denen die heutige Hirnforschung ihrem Gegenstand zu Leibe rückt, die man bei Roth nachlesen kann. Er fasst zusammen: »Durch Kombination all dieser Methoden begann erst vor rund einem Jahrzehnt die genauere Erforschung der neuronalen Grundlagen dessen, was Freud „psychischen Apparat“ genannt hat«.[11]
Subcortex – limbische Zentren – Amygdala: für die Hirnforscher ist es inzwischen ausgemacht, daß diese die neuronalen Schauplätze aller unbewußten Vorgänge sind. Während das Bewußtsein in der Hirnrinde, im Cortex entsteht, ein Produkt der andersgearteten Zellen des Cortex ist. Bewußtes und Unbewußtes arbeiten in je verschiedenen Zellstrukturen. Ein einfacher Übergang aus der einen in die andere Zellstruktur ist nicht möglich. Es gibt also eine handfeste histologische Begründung für die Annahme Freuds, unbewußte Inhalte seien letztendlich nie bewußtseinsfähig; wörtlich: »daß die unbewußte Vorstellung als solche überhaupt unfähig ist, ins Vorbewußte einzutreten, und daß sie dort nur eine Wirkung zu äußern vermag, indem sie sich mit einer harmlosen, dem Vorbewußten bereits angehörenden Vorstellung in Verbindung setzt, auf sie ihre Intensität überträgt und sich von ihr decken läßt«. (Traumdeutung, GW II, 568)
Demnach geht es bei der Neubelebung der im Unbewußten gespeicherten Wahrnehmungen immer um verschobene Darstellungen von Unbewußtem (Deck-Erinnerungen und ähnliches). Es geht um die Übertragung von Intensitäten des Unbewußten, die im Bewußtsein aber andere Inhalte haben. Diese Intensitäten müssen sich dort anderer Inhaltskomplexe als Träger bedienen. Das erhöht nicht gerade die Verlässlichkeit des Unbewußten als Archiv. Zwar speichert es Inhalte (also auch: Dokumentliches); dieses gelangt aber nur in veränderter Gestalt ins Bewusstsein.
Spezifischer zum Gedächtnis sind die Untersuchungen von vor allem Wolf Singer. Als erstes grundlegendes Hindernis für den Versuch präziser Erinnerungen sieht Singer »den Trieb der Menschen, Dinge kausal zu begründen«. Ein Zug, den er in allen Kulturen am Werk sieht: »Menschen haben das unwiderstehliche Bedürfnis, Ursachen und Begründungen zu finden, für das, was sie tun«. (79) Diesen Begründungen, »Kausalisierungszwängen« – die Psychoanalyse sagt: Rationalisierungen – ist prinzipiell zu misstrauen. Denn besonders gern wird das Gedächtnis bemüht, um Begründungszusammenhänge zu belegen, die irgendwelchen strategischen Absichten folgen. Sehr unzuverlässig.
2. Punkt: »Selektive Aufmerksamkeit«. Die allermeisten Reize werden unbewußt verarbeitet, sagt Singer: »Meist nehmen wir nur wahr, was wir ohnehin erwarten, und oft vereiteln auffällige, aber möglicherweise unbedeutende Reize die Wahrnehmung der leisen, aber vielleicht wichtigeren Vorgänge«. (80). »Welche fatalen Auswirkungen dieser biologische Mechanismus auf die Zuverlässigkeit der Berichte von Augen- und Zeitzeugen hat, bedarf keiner weiteren Kommentierung«. (80) Die Langzeitspeicher nennt er entsprechend also das episodische Gedächtnis. Es besteht aus Bruchstücken.
Wichtig für das Langzeitgedächtnis außerdem: »dass Abspeichern erfolgt langsam«. Zusätzlich »bedürfen Engramme der Konsolidierung«, damit sie haften. (83) »Dies hat zur Folge« – ich gebe Singers Resultate wieder – »dass Gedächtnisspuren vollkommen ausgelöscht werden können, wenn innerhalb von Stunden, ja sogar Tagen nach dem Lernprozeß der Konsolidierungsprozeß gestört wird. Im Experiment wird dies meist durch die Unterbrechung der Eiweißsynthese in Nervenzellen erreicht. Und nun die völlig unerwartete Entdeckung: Tiere erlernten in einem Verhaltenstest, dass bestimmte Erkenntnisleistungen belohnt werden, und wiederholte Testung bestätigte, dass sich die Tiere monatelang mit nur geringen Vergessensraten an den gelernten Zusammenhang erinnerten. Dann wurde nach einem dieser Tests die Eiweißsynthese vorübergehend blockiert, und das überraschende Ergebnis war, dass die Tiere im Anschluß daran jede Erinnerung an das einmal Gelernte verloren hatten. Diese Auslöschung der Erinnerung trat jedoch nicht ein, wenn die Eiweißsynthese ohne vorherige Testung und zum gleichen Zeitpunkt nach dem ursprünglichen Lernprozeß unterbrochen wurde«. (83)
Das verwirrt zunächst; man bekommt nicht gleich mit, was er damit sagen/belegen/beweisen will. Was er dann aber formuliert ist ziemlich ungeheuerlich: »Dies bedeutet, dass durch das Erinnern, zu welchem die Tiere während der Testung angehalten waren, die bereits befestigten Gedächtnisspuren wieder labil wurden und dann wieder der gleichen Konsolidierung bedurften wie die ursprünglichen Engramme nach dem ersten Lernprozeß«. (84)
Dieser Vorgang lässt sich sehr gut unter Menschen belegen. Er läuft andauernd im Alltag ab und fällt gar nicht weiter auf, außer dass er zu den bekannten unlösbaren Streitigkeiten unter alten Eheleuten führt, wer was besser erinnert: beide schwören Stein und Bein, die jeweils eigene Version sei richtig. (Präziser Überprüfung halten meist beide nicht stand). Singers resultierender Befund ist höchst einschneidend: »Es bedeutet dies jedoch, dass Engramme nach wiederholtem Erinnern gar nicht mehr identisch sind mit denen, die vom ersten Lernprozeß hinterlassen wurden. Es sind die neuen Spuren, die bei der Testung, also beim Erinnern, erneut geschrieben wurden«. (84)
Das hieße im Klartext: je öfter man eine ‚erinnerte’ Geschichte erzählt, in größeren oder auch kürzeren rhythmischen Abständen, desto weiter entfernt man sie und sich vom ursprünglich gespeicherten Ereignis; desto rabiater wird sie überschrieben, umgeschrieben. Diese Wahrnehmung wird vielen unter Ihnen bekannt sein vom Anhören solcher Repetitionen, die sich auf Erinnerung berufen, aber genau dies eben nicht sind; sondern Überschreibungen aus dem aktuellen Moment (oft opportunistische Überschreibungen, die erkennbar momentanen Zwecken und Absichten folgen).
Singer, nächster Schritt: »Wenn Erinnern immer auch einhergeht mit Neu-Einschreiben, dann muß die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass bei diesem erneuten Konsolidierungsprozeß auch der Kontext, in dem das Erinnern stattfand, mitgeschrieben und der ursprünglichen Erinnerung beigefügt wird. Es ist dann nicht auszuschließen, dass die alte Erinnerung dabei in neue Zusammenhänge eingebettet und damit aktiv verändert wird. Sollte dies zutreffen, dann wäre Erinnern auch immer mit einer Aktualisierung der Perspektive verbunden, aus der die erinnerten Inhalte wahrgenommen werden. Die ursprüngliche Perspektive würde überformt und verändert durch all die weiteren Erfahrungen, die der Beobachter seit der Ersterfahrung des Erinnerten gemacht hat. Was schon für die Mechanismen der Wahrnehmung zutraf, scheint also in noch weit stärkerem Maß für die Mechanismen des Erinnerns zu gelten. Sie sind offensichtlich nicht darauf ausgelegt worden, ein möglichst getreues Abbild dessen zu liefern, was ist, und dieses möglichst authentisch erinnerbar zu halten<. (84)
Dazu kommt, »daß neuronale Speicher als Assoziationsspeicher ausgelegt sind, in denen Inhalte als dynamische Zustände weitverteilter, miteinander vernetzter Nervenzellenverbände definiert sind und nicht wie in Computern einen addressierbaren Speicherplatz belegen«. (85) Vielmehr sind immer eine große Zahl von Nervenzellen und deren Verbindungen beteiligt. Alle neuere Hirnforschung betont die wechselnde Zusammenschaltung verschiedener Hirnteile – Synapsenverschaltung – bei fast allen komplizierteren Wahrnehmungsprozessen.) Was bei Assoziativspeichern dabei »zum Problem wird, ist das Überschreiben des Alten durch Neues. In Assoziativspeichern werden durch Lernprozesse Gruppen von Neuronen in immer neuen Konstellationen zusammengebunden, deren gemeinsame Aktivierung dann die Repräsentation für den jeweiligen Gedächtnisinhalt darstellt«. (85)
»Assoziativspeicher haben die erwünschte Eigenart, Teilinformationen zu ergänzen und zu rekombinieren. Dies ermöglicht die Wiedererkennung von Objekten, auch wenn diese nur ausschnittweise wahrzunehmen sind. Solche Ergänzungs- und Bindungstendenzen können jedoch die fatale Folge haben, dass einmal Eingespeichertes durch jeden weiteren Speicherprozeß, vor allem, wenn dieser ähnliche Inhalte betrifft, in seiner Struktur und kontextuellen Einbettung verändert wird. Im Extremfall kann das dazu führen, dass das Engramm überhaupt nicht mehr im ursprünglichen Kontext aktivierbar ist. Es scheint dann wie vergessen, kann aber dann dennoch – und dann meist zur Überraschung der Beteiligten – in einem veränderten Kontext über neue Assoziationen wieder aktiviert werden. Die Erinnerung lebt wieder auf, aber jetzt in einem anderen narrativen Kontext«. (85)
Daraus leitet Singer ab, dass nichts »unwiederbringlich« verloren geht; durch assoziative Arbeit kann Verschüttetes belebt werden. Im übrigen aber gilt, dass ein Gedächtnisinhalt, je öfter er aktiviert und damit kontextuell neu »überschrieben« wird, das ursprüngliche Engramm immer unzugänglicher macht. Ein- und dieselbe Geschichte (=Erinnerung) zwanzig, dreißig Mal zu erzählen, macht sie also gerade nicht »authentischer«. Sie wird vielmehr bei jedem Mal unzuverlässiger, was ihre frühere Tatsächlichkeit angeht.
Singer: »Wahrnehmungen und Erinnerungen sind also datengestützte Erfindungen. Und weil diese Erfindungen konstitutiv sind für unsere kognitiven Prozesse und nicht Folge vorsätzlichen Täuschenwollens, ist es schwierig zu entscheiden, welchen Berichterstattern wir mit Nachsicht begegnen sollen«. (86)
Fazit (nicht nur) für Historiker: »Geschichte hat demnach die charakteristischen Eigenschaften eines selbstreferentiellen, ja vielleicht sogar evolutionären Prozesses, in dem alles untrennbar miteinander verwoben ist und sich gegenseitig beeinflusst, was die Akteure des Systems, in unserem Fall die Menschen, hervorbringen – ihre Taten, Wahrnehmungen, Erinnerungen, Empfindungen, Schlussfolgerungen und Bewertungen –, und natürlich auch die Geschichten, die sie unwissentlich fortwährend erfinden. Ein Prozeß also, in dem es keine sinnvolle Trennung zwischen Akteuren und Beobachtern gibt, weil die Beobachtung den Prozeß beeinflusst, selbst Teil des Prozesses wird«. (86)
Woraus folgt, dass es weder »die Außenperspektive« noch den »idealen Beobachter« gibt; die »wahre, die tatsächliche Geschichte zu rekonstruieren« demnach nicht möglich ist. (86) Was der vernünftige »Archivar« im Sinne Derridas auch gar nicht erst versucht. Zur »Tatsache« wird werden, »was die Mehrheit derer, die sich gegenseitig Kompetenz zuschreiben, für das Zutreffendste halten«. (86) Also z. B. die Historiker auf einem Kongreß (für die Singer dies hier erzählt); oder die altgriechischen Hexametersänger im Jahr 1000 v. u. Z. beim jährlichen Treffen in Delphi und anderswo, wo um die »gültige Troiaversion« gerungen wird.
Für traumatische Erinnerungen heißt all dies, dass ein ursprünglicher Affekt erinnert werden kann und vielleicht immer wiederholt, traumatisch ausagiert werden will (oder muß; dass aber der Kontext, der zu diesem Affekt geführt hat, komplett ausgetauscht werden kann; und zwar je öfter der Affekt ausagiert wird. Traumatischer Wiederholungszwang hat also die Tendenz, die traumatische Ausgangssituation nicht nur zu überschreiben, sondern sie womöglich sogar zu löschen. Sehr interessant; und in weitgehendem Widerspruch zu dem, was Türcke von der Gedächtnisbildung sagt bzw. annimmt.
Also, was wir hier erinnern wollen in Bezug auf Personen wie Igor Caruso, in Bezug auf die Geschichte der Psychoanalyse oder die Geschichte der Menschheit, hängt davon ab, wen oder welche Gruppe der hier Anwesenden wir als »zuständig« erkennen für die Konstruktion der Geschichte, die wir als »wahr« mitnehmen wollen. Das ist dann die »objektive Wahrheit«, die beim nächsten Kongreß wieder anders überschrieben werden kann
Singer wendet das dann auf die Aussagen in Gerichtsprozessen an, wo er feststellt: je öfter etwas wiederholt ausgesagt wird, desto ungenauer, desto unzuverlässiger wird es. All das legt nahe, dass das sog. objektive Gedächtnis der Einzelperson nicht existiert, nicht existieren kann. Was aber nicht einfach heißt, Erinnerungen wäre grundsätzlich »nicht zu trauen«. Ganz offenbar geht es um die Haltungen, mit denen jemand – ein Einzelner, eine Gruppe, eine Institution, eine ganze Gesellschaft – an etwas »Vergangenes« herangeht – um es zu beleben oder es unter dem Deckel zu halten.
Eine Art Mischgedächtnis haben mehr oder weniger alle: In jeder Person liegen tatsächliche Ereignisse, Ereignisfetzen, Körpergespeichertes, Halbgedachtes, Angefühltes, Normdruck, Erwartungen, exakt vom Bewusstsein Aufgezeichnetes und wilde Projektionen, liegt »Das-was-alle-sagen« und »Das-was-nur-ich-weiß«, jeden Tag im Widerstreit miteinander und bilden die Summe unserer psychophysischen Dunkel oder Zwielichte. Gedächtnis und Auslegung, Gedächtnis und Unschärfe, Gedächtnis und Irrtum, Gedächtnis und Löschung, Gedächtnis und Überschreibung sind jeweils siamesische Zwillingspaare.
Ich will einige typische Formen des Vergessens, wirklichen oder nur angeblichen Vergessens auflisten, wie man sie in unserer jüngeren Geschichte wahrnehmen kann, ohne den Urmenschen und ohne die Hirnforschung zu bemühen.1) Der Täter hat nicht richtig bemerkt, was er tut. Eltern z. B. bemerken oft nicht, wie sie ihre Kinder kränken und können infolge dessen auch nichts derartiges »erinnern«. Je höher jemand in einer Hierarchie ist, desto selbstverständlicher sind die Dinge, die er anderen zufügt, Teil seiner Tagesarbeit. Sie werden höchstens registriert als gerechtfertigte »Machtausübung«, nicht als »Unterdrückung« oder gar »Verbrechen«. Also bilden sich auch keine Schuldgefühle. Die Hierarchie/Institution nimmt sie auf sich, schluckt sie.
Deshalb sitzen Täter aus dem höheren Teil von Hierarchien (z. B. der Dr. Grasser in Claude Lanzmanns Shoah: stellvertretender Kommissar für das Warschauer Ghetto) immer so absolut unberührt, unbeteiligt da. Grasser muß sich sogar informieren lassen (von den Opfern) was denn da (unter seiner Teilherrschaft) abgelaufen ist. »Er weiß nix«. Wieso auch.
2.) Das geteilte Vergessens bei Tätern/Tötern. Lief eine Tötung mit Unterstützung bzw. Billigung der regierenden Autoritäten oder war sie gebilligt von den meisten Menschen drumrum und war sie dazu noch befriedigend genug, spaltet der »normale Mensch« sie ab und hakt sie ab als genehmigt und vergeßbar; und nutzt die freigesetzte Energie zur Verwandlung seiner selbst in einen neuen Körper, der von all den früheren Taten »nichts mehr weiß«; nichts mehr zu wissen braucht.
Geteilter Massenmord ist Purifikation (eins der Grundgesetze der Hitlerkirche). Geteilter Massenmord ist Geburt: Geburtsfest der Nochmal-Erzeugung des tötenden Mannes (resp. der tötenden Frau).
Das Bewusstsein von der geteilten Übertretung, vom gemeinsamen erlaubten Leben im Verbrecherischen scheint die Erinnerung an die begangenen Untaten tatsächlich löschen zu können. (Syndrom des deutschen Vergessens nach Weltkrieg II: wir hatten erlaubte Morde genug…wir hatten die Orgie…und nun, ab 1949, frische und reine Wiederaufbauer ohne Schuld…wir bauen das neue deutsche Unschuldsreich…demokratisch. So etwas klappt nur bei ausreichend gefeierter vorangegangener gemeinsamer Übertretung. Der derartige deutsche Tatmensch (und auch anderswo) lügt demnach wahrscheinlich nicht, wenn er behauptet, sich »nicht zu erinnern«.
3.) To re-win lost wars. Klaus Barbie über seine Folterungen als Gestapochef von Lyon in Marcel Ophuls Film Hotel Terminus: »Ich habe all das vergessen. Wenn Sie es nicht vergessen haben, ist das Ihre Sache«. Weiterer Satz Barbies: »Wer den Krieg verliert, verliert alles«. Soll heißen: auch das Gedächtnis? In gewissem Sinne, ja: die Arbeit dessen, der den Krieg (wie einen Gegenstand) verloren hat und damit Alles verloren, besteht von nun an darin, den Krieg (diesen Gegenstand) wiederzugewinnen. Er weiß und erinnert nur, was zu dieser Aufgabe nötig ist. (Foltertechniken z. B. werden nicht vergessen; aber diejenigen, an denen man sie ausübte, ohne weiteres).
4.) Der Aktenkeller. Politiker oder andere öffentliche Personen, die wünschen, ihr Leben, ihre Taten,. Ihre Obsessionen zu verbergen, räumen genau die Art von Vergangenheit ein, die von Institutionen in Akten festgehalten ist. Das Gedächtnis ostdeutscher Politiker etwa nach 1989 (Lothar de Maizière, Ibrahim Böhme oder Stolpe), die im Verdacht der STASI-Zusammenarbeit standen) ist exakt co-extensiv mit den Aufzeichnungen von Archivakten, die entweder gefunden oder nicht gefunden werden. Was genauso für Waldheim oder Weizsäcker gilt oder, wie es aussieht, für Igor Caruso. Wo nichts gefunden wird, wird auch nichts erinnert. Es existiert nicht. Als wollten sie alle zusammen Michel Foucault bestätigen: das »Subjekt« ist das Kind eines institutionellen Akts, das Konstrukt einer institutionellen Akte.
Wer von Stasi, FBI, Gestapo oder Verfassungsschutz beschäftigt (und entsprechend programmiert) wird, wird nur erinnern, was ein Agent über ihn aufgeschrieben, auf Band genommen oder fotografiert hat. Gedächtnis als Teil von abstrakten Orten, Regalen, Aktenschränken, Gutachten.
5.) Ein Netzwerk von Gleichgesinnten übernimmt (bzw. löscht) die Erinnerungen.Wie dies funktioniert wird deutlich, wenn man sein Gegenstück betrachtet, das wiederholende Agieren. In Claude Lanzmanns Shoah-Film sieht man, wie wiederholendes Agieren das Gedächtnis belebt, bei Tätern wie bei Opfern. Die polnische Bevölkerung des Örtchens Grabow begibt sich vor Lanzmanns Kamera in einen Prozeß des »Wiederdurchlebens« der Situation von 1942. Vom Schicksal der Juden in Grabow berichtend, versammelt vor der Kirche am Fronleichnamstag, beleben sie ihren Antisemitismus neu und agieren ihn noch einmal aus gegenüber einem Überlebenden der damaligen Vernichtung, Simon Srebnik, den Lanzmann mitgebracht hat. Er steht in ihrer Mitte und erstarrt ob ihres erinnerungsreichen Redeflusses als der Nochmal-Getötete.
Warum »erinnern« sie sich so gut? Mehrere Gründe. Im Hintergrund des Bilds sieht man die schuldreinigende Kirche, die hier das Wiederaufflackern des »Gedächtnisses« zulässt sowie die unverminderte Wirkkraft seiner zugedeckten Inhalte. Unter den Fittichen der Institution Kirche, unter deren Schirm sie sich hier versammeln und deren erteilter Absolution sie sich sicher sind, können die polnischen Bauern sich »erinnern«, weil eine subjektive Zuschreibung ihrer Taten damit ausgeschlossen ist: »Jeder wusste, was in Chelmno passierte…ja, wir alle«; aber die Schuld ist entsubjektiviert, auf die »Zeitumstände« umgelagert, auf ein altes göttliches Gesetz, das sie auch aussprechen: Bestrafung der Juden für die Kreuzigung Jesu; entlastet von der Mutterkirche; und »wir sind ja nicht die Deutschen«. Unter diesen Umständen funktioniert sogar das Detailgedächtnis (nach über 40 Jahren) erstaunlich gut. Wirklich »vergessen« wurde hier nichts. Das könnte Singers Befund von den Überschreibungen stützen. Die Einwohner von Grabow haben ihre damaligen Eindrücke nicht überschrieben, da jetzt, nach über vierzig Jahren, zum ersten Mal ein Überlebender der damaligen Vernichtung auftaucht und mit Lanzmann und seiner Kamera zum ersten Mal jemand, der sie genau nach damals befragt. Und siehe, alles ist ganz frisch.
Beim jüdischen Friseur Abraham Bomba ist es das Wiederholen der Haarschneidegesten, die er beim Scheren der Todgeweihten im Raum vor der Gaskammer machen musste, die ihm das Geschehene wieder zugänglich macht. Lanzmann erzählt, dass der Haarschnitt im Film ein inszenierter Haarschnitt ist; man sieht im Film, wie Bomba sich dieser aktivierenden Wiederholung, die zu einer Wiederholung werden soll, zu entziehen sucht. Beide merken, dass der Einstieg in die alten Gesten nicht nur die zugehörigen Erzählungswörter hervorbringt, sondern auch die tief vergrabenen Emotionen. Bei der ersten, »nur erzählerischen« Wiederbelebung des Haareschneidens vor der Gaskammer bleibt er noch »gefasst«. Bei der zweiten, zu der Lanzmann und die Kamera ihn bringen/zwingen, bricht er beinah zusammen und es bricht aus ihm heraus. Nur die anwesende Kamera stabilisiert den in der Erinnerungsarbeit zusammenbrechenden Körper: das Wissen, in dieser Inszenierung Gefühle hervorzubringen und zu zeigen, die sonst nie mehr und für niemanden sichtbar werden würden, hält Bomba zusammen und fügt ihn neu zusammen. Man glaubt (man möchte jedenfalls glauben), auch ihn hätte dies erleichtert; ihn verbunden mit einem verschütteten Teil des Selbst, der ihm allein nicht zugänglich gewesen wäre (Auflösen des Anästhesiepols). Gedächtnisarbeit in dieser Funktion ist, wie Liebesarbeit, eine Arbeit zwischen Zweien, eine Coproduktion.Die filmische Erinnerungsarbeit bei Lanzmann hat diese vier Bestandteile: die tatsächlichen Orte; die Fahrbewegung der Züge/der Kamera dort hin; das Sprechen der überlebenden Opfer oder Augenzeugen und ihre neue Verbindung mit jetzigen Lebenden in der Re-Inszenierung von Ereignissen. »Erinnern« ist hier eine Arbeitsform, eine Kunstform; es hat nichts zu tun mit dem sog. Gedächtnis und seinen Kapazitäten, seinen »Lücken« oder was immer: Diese schließen bzw. öffnen sich, sobald die Arbeit beginnt. Der Satz »Das weiß ich nicht mehr; das habe ich vergessen«, bezeichnet überhaupt keinen Sachverhalt des sogenannten Gedächtnisses; er bezeichnet etwas ganz anderes: eine Arbeitsverweigerung in der Annäherung an Geschichte.
Dies Privileg der Arbeitsverweigerung (vor der Geschichte) haben sich die betroffenen Deutschen offiziell, kirchlich/staatlich nach dem Weltkrieg und nach der Shoah, eingeräumt.
Ist das eine Form von Lüge? Eine Form von Verdrängung? Oder eine Form von Absperrung, wie Kurt Fallend zu sagen vorschlägt. Zur Annahme »Verdrängung« würde ich sagen: nein. Aus den Aufzeichnungen aller Nazi-Täter, aller Freikorpsleute, mit denen ich mich befasst habe, geht hervor, dass sie immer ganz genau wissen, was sie planen und was sie getan haben. Sie streiten es ab, wenn in Bedrängnis. Sie schreiben ihre Taten anderen zu (»den Roten«, »den Judenׂ). Aber Verdrängung liegt nicht vor. Im Gegenteil: sie brüsten sich mit ihren Taten, wenn im »sicheren Raum«, wenn entsprechend »unter sich«.Absperrung könnte man es eher nennen. Absperrung ist ein sozialer Prozeß, kein psychischer Mechanismus wie die Verdrängung. »Abgesunken« ins Ubw wäre hier nichts. Es läge vor, aber: »Ich laß das in diesem Moment nicht an mich ran bzw. nicht aus mir raus« (in anderen Momenten aber vielleicht doch). Die Absperrung kann man aufheben, mit einer Absicht, man kann sie aufheben nach Bedarf. Die »Verdrängung« nicht; sie ist ein unbewußter, ein nicht beliebig steuerbarer Prozeß.
Es kommt wohl entscheidend auf die äußeren Wiederbelebungsumstände an, ob man etwas Gespeichertes belebt und ausspricht; oder ob man es begraben hat, weggeredet und überschrieben in vielen Anläufen, die die Tatsachen selbst »immer blasser« werden ließen. Es kommt darauf an, ob man die Erinnerungsarbeit leisten will oder eben gerade nicht.
Frage also: würde der Dr. Grasser und all die andern deutschen Beteiligten, Halbbeteiligten oder Zuschauer ihr Gedächtnis wiederbekommen, wenn sie die Chance geboten bekämen, im sicheren Kreis Gleichdenkender das Sterben der Juden im Warschauer Ghetto nachzufeiern…unter SSlern die Folterungen nachzubegehen… die Vergasungen…»war ja Befehl«…»unausweichlich«…von Institutionen gedeckt… Befehl vom Führer selber…»und verdient hatten sie’s auch«.Die Frage stellt sich genauso für Caruso und viele andere, die Teile ihrer Vergangenheit aus bestimmten Gründen verbergen. Sie lautet: was alles wurde oder wird »erinnert« im »Kreise« alter Freunde und Kollegen; im Kreise der Mitwisser bzw. Mittäter in Anstalten wie dem Spiegelgrund. Was »erinnern« die Seilschaften, was die Netzwerke gegenseitiger Förderung. In ihnen liegt eine gegenseitige Übereinkunft des Nichtaussprechens nach außen vor; hinter der aber ein ziemlich genaues Wissen steckt; sonst bräuchte man sie nicht, die schützenden Old-Boy-Netzwerke. Es liegt nahe, dass sich unter schützenden Netzwerk-Bedingungen ein gut Teil des vergessenen, des »amputierten« Gedächtnisses ganz anständig regen und sich wieder einfinden würde bei allen möglichen – sonst »Nichts-Wissenden« – Tatbeteiligten.
Daß Igor Caruso Teil eines solchen katholisch-existentialistischen und teils austrofaschistischen Netzwerks war bzw. Beziehungen zu Schlüsselpersonen solcher Netzwerke unterhielt, entnehme ich dem Aufsatz von Eveline List. Die Punkte 4.) und 5.) der obigen Liste »typischen Vergessens« könnten auf ihn zutreffen: »Aktenkeller« und »Netzwerk Gleichgesinnter« als Löschkräfte der »Erinnerung«; und als Produzenten jener verdunkelnden Andeutungsprosa, derer er sich bedient in seinem Radiointerview vom April 1979. Ich höre aus jeder Wendung dieses Interviews, dass er viel mehr weiß und auch erinnert, als er sagt. Kunstvoll bemüht, ja nicht mehr durchsickern zu lassen, als »die Welt« sowieso schon weiß (Prinzip Aktenkeller).
»Vergessen« ist vermutlich nichts; aber weggesperrt. Das »Gedächtnis«, wenn man es noch so nennen will, befindet sich offenbar in wechselnden Zuständen der Verfügbarkeit; kann eingeschaltet, abgeschaltet, benutzt, überschrieben, verändert werden; als Dokumentar-Ort, als Archiv-Ort ist es höchst unzuverlässig. Archiv-Ort im Sinne Derridas würde es ohnehin erst, wo sich sein Träger in die Geschichte einschreibt, diese und sich selbst verändert; die Geschichte weiterschreibt auf etwas Zukünftiges hin. Solch eine Arbeit übernimmt mit der Nazi-Geschichte in meinen Augen das Buch Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell.
Die Arbeit der Akteure der vergangenen Geschichte ist in der Regel eine andere; wenn nicht die von Leugnern dann die von Technokraten der Überschreibung. Es musste dabei nicht notgedrungen gelogen werden. Konrad Adenauer stritt im Fall Globke nicht dessen Tätigkeiten für den NS-Staat ab; er untertrieb nur und äußerte in seiner »rheinischen Offenheit«: »Tut mir leid, ich hab keine anderen Leute«.
Kiesinger, selber Täter, versteckte und verbarg schon eher. Er musste geohrfeigt werden von Beate Klarsfeld, damit etwas zum Vorschein kam. Für andere zum Vorschein. Er selbst blieb mit sich im Reinen.
Oder nehmen wir Carl Schmitt und Heidegger. Heidegger, der sich immer darüber klar war, welchen Anschlag auf die deutsche Universitätsverfassung er unternommen hatte 1934: Installierung des »Führerprinzips«; mit ihm selber als Führer an Stelle Hitlers; – vergleichbar Carl Schmitts iuristische Rechtfertigung von Führerprinzip und Angriffskriegen – waren sich einig: »Niemals von mir ein „pater peccavi“« Bereut wird nichts. Zurückgenommen wird nichts. Helmuth Lethen hat beschrieben, wie Heidegger und Schmitt sich ärgerten über einen möglichen Dritten im Bunde. Dieser – Gottfried Benn – zeigte Anzeichen von Rücknahmen; bedauerte seinen offenen Brief im Naziradio 1933 an Klaus Mann. Benns Abwendung vom nationalsozialistischen Staat begann etwa 1936; mit einem interessanten Resultat. Ende der Dreißiger kann er wieder Gedichte schreiben; moderne Lyrik, die den Namen verdient. Seine schriftstellerische Potenz kehrt zurück.
Für Klaus Heinrich war klar: das, was er die Selbstzerstörung der Gesellschaft bzw. der Universität genannt hat, rächt sich. Wer nicht spricht, wer das Gedächtnis abschottet, wird starr. Das »Pater peccavi« wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich finde es interessant, zu hören, dass unter Ihnen zu Carusos Schriften die Meinung vorherrscht, besonders Erinnerungswertes habe er nicht hinterlassen. Das mag solche Gründe haben. Benns Rücknahmen führen zu guten Gedichten. Was er zurücknimmt? Zumindest die Selektionsideen seiner Züchtungs-Texte von 1934.[12]
Selektion. Genau damit war Caruso befasst 1942. Die ganze deutsch-österreichische Welt (soweit sie nicht getötet oder emigriert war) war befasst mit Selektion 1942ff. Testverfahren im Spiegelgrund, von denen man nicht gewusst hätte, wofür sie womöglich gebraucht würden? Absurd, sagt meine Frau, Psychoanalytikerin mit 27-jähriger Praxis in der klinischen Kinder- und Jugendpsychiatrie; Erfahrung mit allen Sorten Tests. »Tests sind erfunden worden zur Selektion«, sagt sie. »Bei jedem Gutachten besteht die Gefahr, wenn man nicht aufpasst, dass es einer Selektion dient«.
Zumal 1942, im großen Selektionskrieg. Ein Blick in ein einziges Caruso-Gutachten genügt: »Der reich entwickelte Wortschatz des Kindes, das Benennen vieler Gegenstände, einzelne sinnfällige Bemerkungen (z. B. dass die Heizung mit Wasser geht oder die stehengebliebene Uhr aufgezogen werden kann), und spontane Äußerungen zeigen, dass die Potenz seiner Intelligenz viel mehr entwickelt ist, als sie bei einem angeborenen hochgradigen Schwachsinn sein könnte. Andererseits die vollkommene Zerfahrenheit der intellektuellen Leistungen, die weitgehende Störung des assoziativen Denkens, die autistischen Züge, die vermutliche Anwesenheit von Wahnvorstellungen, die pseudologischen Momente, die Neigung zum Negativismus, die Perseverationen, die Stereotypien, begründen den Verdacht an die Schizophrenie oder an eine schizophrenisch gefärbte Form der Kinder-Demenz mit hochgradiger Verblödung«. Das ist volle Pulle der ganze Sack gutachterlicher Verdächtigungen, die so ein Anstaltstester überhaupt auffahren kann. Die Formulierung vermutliche Anwesenheit von Wahnvorstellungen lässt einen schreien. Solche sind beim Gutachter vorhanden, fraglos; ob auch beim getesteten Jungen lässt sich hieraus nicht sagen. Zwischen Februar und Oktober 1942 erstellt Caruso über einhundert solcher Gutachten.
Gewußt – nicht gewusst; Wissen – Nicht-wissen-wollen. Sind das überhaupt psychische Zustände? Denken Sie an die Sätze Nietzsches, die ich eingangs zitiert habe; geschrieben vor der Jahrhundertwende. Nietzsche beklagt, ohne von Weltkriegen zu wissen, die Tötungs- und Foltergewalt als einen Kern unserer Geschichte. Von Anfang an da in unserer Kultur, sie prägend; nicht nur im »finsteren Mittelalter«. Was kann da heißen »nichts gewusst«, bzw. »selber nichts getan«, mitten im Orkan allgegenwärtiger Vernichtung. Mit solchen Aussagen dokumentiert man nur sich selbst als Schwachkopf, die eigene absolute Ahnungslosigkeit vor der Geschichte; oder sich selbst eben als Lügner, oder auch als beides.
Die Frage bei Caruso kann nicht sein: was hätte er wissen können oder müssen (selbstverständlich hat er gewusst und hat er getan; und später höchst undeutlich geredet und so geredet, als hätte er nicht getan). Die Frage müsste vielmehr sein, bei wem oder zu wem hätte er reden können oder sollen gleich nach dem Krieg oder später, als Professor, in den 70er Jahren. Man kann ja von niemand verlangen, sich freiwillig und schutzlos einer tendenziell gnadenlosen Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen, ganz gleich, was jemand tatsächlich getan hat. Wo wäre das Ohr gewesen – außerhalb der katholischen Absolutionsindustrie – das bereit gewesen wäre, nicht nur hinzuhören, sondern auch zu vergeben. Und vielleicht hat jenes abstrakte Ohr des eigenen Old-Boy-Netzwerks, das immer wissend und beschützend da ist, gerade wenn man nicht spricht, ja genügt, um mit sich selber in eine aushaltbare Balance zu kommen; auch als Hochstapler oder Etikettenschwindler.[13]
Das führt mich zum letzten Punkt; zum Bau der Person, grob: der mitteleuropäischen Person, wie sie heute vorliegt und wahrscheinlich schon seit ein paar Jahrhunderten. Ich glaube, mit jenem ödipalen Konstrukt, das Freud auf den Bühnen von Ich/Es/Über-Ich in Aktion sah, hat sie nicht viel zu tun. Das weiß ich seit der Beschäftigung mit dem »soldatischen Mann« in Männerphantasien: der Freud’sche Entwurf der Person kommt faktisch unter Menschen kaum vor. Vielleicht war Freud selber so einer und noch ein paar, ein paar Handvoll glücklicher Leute mehr. Unter den andern, den tatsächlichen Menschen, dominieren Borderliner, »Psychotiker«, Menschen mit fragmentierenden Körpern, ständig bedroht von massiver Destabilisierung.Diesen Befund denke ich aber seit einiger Zeit etwas präziser. Das liegt u. a. an einem Buch mit dem deutschen Titel Arm und reich, Autor Jared Diamond. Originaltitel: Guns, Germs, and Steel (geniale Übersetzer in deutschen Verlagen). Dies Buch widmet sich den dominanten Kulturprinzipien der eurasiatischen Menschheit seit etwa -10.000; seit Durchsetzung des Ackerbaus (Saatauslese) und der Errungenschaft der Haustierzucht. Die Domestizierung von Wildtieren – das war mir nicht so bewusst – basiert, selbstverständlich (möchte man sagen) auf Selektion: sie segmentiert (selektiert) bestimmte Tiere, sondert sie ab, studiert ihre Eigenheiten, ernährt sie künstlich, und sequenziert sie dann (durch Zucht). Sie greift kultivierend derart in die Naturprozesse ein; dass von hier an jeder entscheidende Entwicklungsschritt der Menschheit(en) dieses Raums als ein Kunst-Prozeß angesehen werden muß; verbunden mit jeweiligen Gehirnsprüngen, über den Ackerbau bis hin zum Schiffbau und zur Metallschmelze, die als Vorbedingungen des schließlich entscheidenden Sprungs zum griechischen Vokal-Alphabet und zur euklidischen Geometrie angesehen werden müssen.
Es sind jeweils Technik-Sprünge; Sprünge zu neuen Techniken und Technologien, die jeweils kleinere Gruppen zuerst unternehmen, die dann aber zum Allgemeingut der Angehörigen dieser Kultur(en) werden. Technikstrukturen werden zu körperlichen Strukturen, werden zu psychischen Strukturen. Haustierzüchtung mit den Segmentierungen von Hund, dann Schaf, Ziege, Geflügel; schließlich um -5000 das Pferd. Menschen setzen sich an die Stelle der Schöpfung…stellen Zivilisation her…geraten selber in die Schöpfungsposition. Alle geschriebenen »Götter« der späteren Bibeln sind schon keine mehr…der eurasiatische Mensch bewaffnet sich mit Züchtungstechniken…Züchtungswaffen…griechische Götter gegossen aus Bronze… bis zu 16m hoch…
Unser kulturelles Gedächtnis ist gebildet aus dem Ensemble all dieser Techniken und Technologien; auch die Analphabeten bei uns blicken zentralperspektivisch und euklidisch geometrisch. Mancher kann vielleicht nicht schreiben, aber den Motor einer Harley auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, das kann er dafür.Im Vokalalphabet um -800 kulminiert dieser ganze technologische Vorlauf und erreicht seine noch heute weitgehend gültige Form: Alphabet aus 26 Segmenten… Buchstaben, aus denen die Welt sich zusammensetzen lässt und immer wieder neu zusammensetzt seitdem. Sequenzen bilden: alles aufschreiben, alles speichern… dann einleiten der nächsten Schritte. Was selbst die größten Leugner des sog. menschlichen Fortschritts nicht leugnen können: den technologischen Fortschritt in der Entwicklung unseres Kulturkreises. Schließlich erzeugt die Renaissance nach Anwendung der Gesetze von Euklid auf die Dingwelt und die künstlerischen Welten die mathematische Linearperspektive.
Segment…Sequenz…unsere Körperlichkeit bis heute ist davon bestimmt. In der sog. Conquista zeigt sie ihre ungeheure Überlegenheit über den Rest der Welt. Cortez in Yucatan…Thomas Harris und die englischen Siedler in Virginia, Nordamerika. Die Engländer wenden ganz bewusst Macchiavelli-Theoreme an. Überprüfen, wie das geht: eine neu entdeckte Kultur zu beherrschen, indem man sie mit einer neuen »überlegenen« Religion konfrontiert. Klappt wunderbar: die Indians glauben, dass Kompaß und Sixtant von den Göttern der Weißen verliehene Geräte sind. Sie glauben, dass sie reihenweise sterben, weil die weißen Herren sagen, sie würden falschen Göttern anhängen und deshalb bestrafe sie der nachweislich überlegene Gott der Weißen.
Strafe für falsche Religion. Wie Cortes es vorgemacht hat mit den Azteken: »Unsere Pferde wiehern und stampfen mit den Hufen? Ja, weil ihr nicht den richtigen Glauben habt. Aus unseren Pferden, die so wild wiehern, dass es euch Angst macht, spricht die Stimme unseres Gottes, der unzufrieden ist, weil ihr immer noch euren falschen Göttern anhängt«. Und also zerdeppert er ihre Götterstandbilder – die sich nicht wehren; Beweis der aztekischen Unterlegenheit. Die Europäer wissen ganz genau, dass sie schummeln und tricksen mit jedem Satz. Aber »lügen«? Bewahre. Sie sind so überlegen wie sie sich fühlen; und ihrem Gott ist das gefällig. Den stört es nicht, dass die Hengste nicht seinetwegen wiehern, sondern weil Cortes Stuten hinter der Zeltleinwand aufgestellt hat – unsichtbar für die Kaziken von Tabasco – damit die Hengste verrückt spielen. Sie sind komplette Technokraten ihrer Tätigkeiten. Die Landschaftsskizzen, die sie anfertigen, sind lesbar für jeden analphabetischen spanischen Soldaten in Kategorien von »so und so viele Tagesmärsche von da bis dort«. »Wie hoch jener Berg? Wie weit oder wie breit jener Fluß?«. Die Zeichnungen der Indios, die Moteczuma sich anfertigen lässt sind dagegen komplett raumlos. Keine Distanzen, keine Perspektive, keine Größenrelationen. Die Boote der Azteken: ohne Segel; keine Form der Navigation ist entwickelt. Ihre Strategien suchen sie durch Priester aus den Eingeweiden von Opfertieren oder geopferter Menschen abzulesen. Sie sind religiös, abhängig von Götterweisungen. Während die Europäer die Götterweisungen, die sie brauchen, nach Bedarf anfertigen. Religionstechnologen.[14]
Im europäischen Renaissancekörper liegt all das sowohl gebündelt als auch nebeneinander vor…der Eroberer, der er körperlich ist, ist jemand, der ein Schiff führt…eine Stunde Steuermann oder Kapitän ist…dann Kaufmann…Mathematiker… dann Soldat…dann zu Hause Kindsvater…Liebhaber (Befehlshaber) der Frau…dann Nachbar…Tierzüchter…Hundedresseur…einen Tag in der Woche Kartenspieler… Kalkulateur des Winterbedarfs an Kohlen und Kartoffeln; die technische Moderne erweitert das Ganze: Fotograph…Volleyballspieler…Operngänger…Musikfreak… Architekt, etc. In unserer vorherrschenden Charakterstruktur sind wir seitdem Funktionalitäten solcher Aufspaltungen. Spaltung…Freuds Begriff: Ich-Spaltung. Aber nicht nur im »Abwehrvorgang«, nicht die Schizo-Spaltung, sondern multifunktional…von 8 Uhr bis 9 Uhr: religiös…von 9 bis 10 im Büro: ein weltlicher Gauner…Um 11 eine Spende für die Hungerhilfe…aber um 12 ordentlich essen…ohne schlechtes Gewissen…Was die Zustände der Welt und »der Gesellschaft« angeht?: »Der Gesellschaft ein Bewusstsein ihrer selbst zu schaffen?« »Wir wissen alles«. Das Archiv quillt über. »Wir wissen alles. Aber wir denken nicht dran«. Würden wir an alles was wir wissen, dauernd denken: es wäre unaushaltbar. So spalten wir ab. Es gibt muskuläre Abspaltungen…körperliche Bearbeitungs- und Abfuhrvorgänge…es gibt die geistigen sog. »Ablenkungen«…das Theater…den Golfplatz…die Abfuhrorte… Kneipen…Clubs…Stadien…Bordelle…Kaufhäuser…Saunen…die metaphysischen Orte…Kirchen…& das riesige Spektrum der Technologien…Fahrräder…Autos …Flieger… Computer…sie alle sind auch Teil und Aktionsorte der psychischen Abspaltvorgänge der Einzelnen. Wobei das Besondere und auch Entscheidende ist: niemand hier empfindet diese Spaltungen als krank oder als Behinderungen. Sie sind einfach die Art und Weise, in der wir, in der unser eurasiatischer Kulturkörper gelernt hat zu funktionieren im Lauf der Jahrtausende unserer Geschichte. Unsere Kulturaufgabe im Alltag: die Spaltungen so auszubalancieren, d. h. so reibungslos vom einen Zustand auf den anderen umzuschalten, dass wir als gesunde gut funktionierende Beherrscher unseres Alltags erscheinen und uns entsprechend darstellen. Das heißt bei uns: Erfolg.[15]
Carusos Tätigkeiten zwischen Euthanasiebeteiligung und Mit-Entwicklung einer universitären emanzipativen Sozialpsychologie sind dann nicht unbedingt so »widersprüchlich« wie sie erscheinen, wenn man sie unter politisch-moralischen Gesichtspunkten betrachtet. Im System der Umschaltungen von einem Daseinszustand oder besser Körperzustand in den anderen gibt es keine solchen Widersprüche. Es gibt wahrscheinlich den Körperzustand, in dem jemand wie Caruso – und er ist ja kein Einzelfall – etwas von seiner Tätigkeit im Wiener Spiegelgrund weiß; und in den anderen, das sind die zahlreicheren oder dominanten Zustände, weiß er nichts davon. Daß er vernünftige Sachen gemacht haben kann im Sinn seiner Studenten ist nicht ausgeschlossen. Eichmann in Buenos Aires war ein angenehmer Bürokollege und erschien nach außen als überzeugender Familienvater…er machte seine Beobachter, die Herren vom israelischen Mossad, tatsächlich unsicher, ob er wirklich der sei, nach dem sie suchten…
Andererseits: es gibt Menschen bei uns, die solch eine Struktur erkennen…die ihr selber so wenig unterworfen sind, dass sie einen Blick dafür haben…man muß sehr entwickelt sein in seiner Wahrnehmung, um so etwas zu erkennen…eine Menge analytischer Erfahrung haben um zu sehen…»Wie der da wieder lächelt…wie er da mit dieser Studentin rummacht«…nur wenige sehen dass…und die meisten wollen gar nicht…wahrscheinlich weil zu ähnlich strukturiert…
I. C., junger fremder Mann, sah eine Aufstiegsmöglichkeit in Wien…vielleicht war keine andere da…man belastet sich nicht mit so etwas ein Leben lang…das ist allgemeine Lehre in unserer Verhaltens-Kultur.
Der Fall Hans Strotzka demgegenüber, vom dem wir gehört haben, dass er sich schämte; dass er alles aufgeschrieben hat, was ihn quälte und dass er es veröffentlichen wollte: er war sicher nicht der einzige. Und was geschieht: die Familie sagt, tu’s nicht. Laß das, mach das nicht. Du entlastest vielleicht dich; aber uns belastest du…wir sind dann die Kinder dieses Mannes mit der SS-Vergangenheit…das haftet…Erinnerung stinkt…Scham ist ein starkes Gefühl, ist ein gutes Gefühl, ein reinigendes: sie überschwemmt einen, man löst sich auf…man möchte im Boden versinken…ein ungeheuer starkes intensives Gefühl. Sie eröffnet die Möglichkeit, ein anderer zu werden…die Möglichkeit der Körperveränderung…wie manche Drogen…wie die auflösenden Trancen…Auflösung des alten Körpers ist ein Weg…wahrscheinlich der einzige Weg…
Gerhard Roth, der Neurobiologe, sagt: emotionaler Aufruhr ist nötig. Sonst kommt man nicht raus aus der alten Struktur. Das ist auch eine der Wirkweisen von Kunstwerken…die Berauschung durch Kunst, die zur Häutung führen kann und zu einer neuen Anordnung der eigenen Körperlichkeit. Ringt sich aber jemand durch, kommt die Umgebung, kommen die Spaltungsprofis, und rufen, im Chor: »Laß das bleiben!…«
Ein sehr schöner Film von Claude Chabrol um 1970, Michel Bouquet, Stephane Audran. Bei Anbruch der Nacht. Gehobene Bourgeoisie in Paris. Michel, der Ehemann, bringt den Liebhaber seiner Frau um. Sie ahnt, dass er es war; schließlich weiß sie es. Sie deckt ihn. Schönes Haus, schöner Garten, tolles Kind, alles Bestens. Aber er hält es nicht aus. Er will reden, will zur Polizei. Und was macht sie? Sie gibt ihm eine Überdosis seiner Herztropfen, bringt ihn um. Der Garten, das Kind, es muß erhalten bleiben, alle Fassaden. Bloß nichts Offenes. Und wenn er das nicht schafft, wenn er die Spaltungen nicht aufrecht erhalten kann, wenn er mit dem Toten, den er angerichtet hat, nicht leben kann, muß er selber weg. Ein paar Tropfen mehr also in sein Glas. Unauffälliger Tod. Kein Mord, bewahre.
Das spricht, glaub’ ich, vom Kern unserer Kultur.
[1] Vortrag auf dem gleichnamigen Symposium in Graz, 2010.
[2] K. Heinrich, „Festhalten an Freud“, in ders., Der Staub und das Denken, Fft. 2009, S. 86
[3] K. Heinrich, ebd., S. 100f. Wobei der letzte Satz, je nach Betonung, einen Doppelsinn entfaltet. Die »eigenen selbstzerstörerischen Prozesse« sind bezogen auf das Objekt des Satzes, »sie«, im gemeinten Sinn: die Gesellschaft. Das »sie« lässt sich aber auch lesen als bezogen auf »sie«, die Universität. Auch diese, so der unbewußte Unter-Sinn des Satzes, hätte sich aufzuklären gehabt (und weiter aufzuklären) über die »eigenen selbstzerstörerischen Prozesse«
[4] Jacques Derrida, Dem Archiv verschrieben, Paris 1995; Brinkmann & Bose, Berlin 1997, S. 1f
[5] J.Derrida., ebd. S. 122f
[6] Und auch bei Nietzsche also schon eine Art »Zitat«
[7] Martin Bormann, unbehelligt alt geworden wohl in Syrien…kein Klarsfeld-Finger konnte daran kratzen, bis jetzt…
[8] Christoph Türcke, Philosophie des Traums, Beck Verlag München 2007, Zitate S. 61ff
[9] Sebastian Leikert, Die vergessene Kunst. Der Orpheus-Mythos und die Psychoanalyse der Musik, Psychosozialverlag, Gießen 2005. Zitate aus dem Kapitel „Linguistische und genetische Aspekte der Musikerfahrung“, 54-56
[10] Gerhard Roth, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Fft 2001, Zitate aus dem Kapitel „Neurobiologie und Psychoanalyse. Oder; Hatte Freud Recht?“, 430-441
[11] Die meisten Annahmen der Hirnforschung vor 1990 kann man demnach getrost vergessen.
[12] »Hans Strotzka, der an seiner raschen Annäherung an die Nazis in ganz jungen Jahren sichtlich litt – er war Mitglied der NSDAP und der SS gewesen, was er stets als persönlichen Fehler öffentlich bekannte und bedauerte – und der als einziger in der WPV immer wieder ansetzte, zwar nicht unambivalent, aber offen dazu Stellung zu nehmen, wurde ein „Geständniszwang“ nachgesagt« (List, S. 137). Zahlen demgegenüber die Anhänger der „Geständnis-Verweigerung“ mit geistiger Lähmung, mit wissenschaftlicher Unproduktivität?
[13] Unter den vielen Linken, bei denen im Lauf der 70er und 80er Jahre jeweils zwei Herren vom Verfassungsschutz auftauchten, um sie zur Mitarbeit anzuwerben (die »Stasi West«, deren Akten bis heute nicht zugänglich sind), fallen mir zwei Freunde ein, einer von ihnen ein Anwalt, die sich zum Schein auf dies Angebot einließen, um zu sehen, wie dieser Verein so arbeitet. Um später (bei irgendwelchen gezielten Aktenöffnungen) nicht womöglich als »Spitzel« beschuldigt werden zu können, legten sie ihre Rechercheabsichten schriftlich bei einem Notar nieder.
[14] Ohne davon zu wissen, wurde die Haustierdomestikation dabei zur stärksten Waffe der Eurasiaten in der Conquista. Mikrobiologie und Genforschung belegen (nach Jared Diamond), daß 95% der Ureinwohner der beiden Amerikas an Haustierviren gestorben sind; jenen Viren, gegen die die Spanier, Engländer, Franzosen usw. immun waren. Die Eurasiaten kommen als bewaffneter Körper.
[15] In Gesprächen nach dem Vortrag erzählten mir Hörer, die professionell in Südamerika bzw. Afrika zu tun haben, dass »die Menschen dort«, mit denen sie arbeiten, Schwierigkeiten mit genau dieser Struktur haben. Ihnen gelingt »das Umschalten« nicht von einem Zustand auf den nächsten, wie den Europäern. Sie hängen mit ihren Empfindungen und Gedanken noch »ganz woanders«, etwa noch »bei den Kindern«, wo doch im Moment schon etwas ganz anderes gefordert ist. Aus nichts anderem würden die europäischen Standardvorwürfe resultieren: Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit, Konzentrationssschwäche. (Der eurasiatische Mensch: automatisch in der Gutachterposition).
***
Ja, danke, lieber Siegfried Zielinski, für die ausführliche Einführung und die Einladung zu den Vilém Flusser-Lectures – es wird gehen um Musik und Psychoanalyse und darum, was die neuere Hirnforschung zum Musikhören und zur »Übertragung« zu sagen hat ‑ Felder, die auch Vilém Flusser immer beackert hat: seit Jahren gehen mir die von Flusser ja nicht mehr zu Ende gedachten oder zu Ende bewiesenen Formulierungen aus seinen letzten Arbeiten im Kopf herum, Die Schrift insbesondere; Gedanken, die sich um die Ablösung des Alphabetismus als unserem kulturellen Leitmedium drehen, sowohl was die Speichermedien angeht wie die Entwicklung und Formulierung des jeweils neuen »Denkens«. Die Dominanzfunktion, die der Alphabetismus von Beginn unseres technisch-medialen Denkens seit knapp 3000 Jahren hat, geht laut Flusser zu Ende. Sie wird abgelöst durch Digitalität, mathematische Formeln, digitale Formeln, digitale Raumkonstruktion durch Computerisierung. In einem immer noch irrwitzigen Sprung behauptet Flusser, diese würden die Hirnstrukturen der digitalisierten Menschheit, die Hirnstrukturen der jungen, der elektronisierten Generation so einschneidend verändern, ja, hätten sie schon so verändert, dass wir, die wir ja am Alphabetismus noch hängen, mit ihm groß geworden sind als unserer medialen Muttermilch, inzwischen so etwas wie die neuen Analphabeten wären, die von dieser Kulturtechnik des Digitalen überholt, überrollt worden seien. Wissenschaftler in der Ökonomie, Physiker, Mathematiker, Chemiker, Weltraumforscher würden, so Flusser, nicht mehr in grammatischen Sätzen kommunizieren, wenn sie ihre Ergebnisse austauschten. Sie würden sie nur noch übersetzen für solche, die ihren Formeln nicht folgen können, also für uns, wenn sie vor der Notwendigkeit stünden, den andern, der interessierten Öffentlichkeit mit ihren Politikern und Journalisten (den Analphabeten), den Stand der Dinge zu erklären.»Beweise« dafür gibt es bis jetzt keine, vor allem nicht für den Flusser-Satz, diese verschiedenen Kulturformen, Denkformen, Gehirnformen seien nicht kompatibel miteinander. Bei der jetzigen Generation, wo das digitale Denken, ohne dass sie es selber bemerkt hätten und wissen, von ihnen Besitz ergriffen hat, von ihrem Hirn, sei das, so Flusser, mit Alphabetismus nicht mehr vereinbar. Uns, den heutigen Alphabet-Intellektuellen, falle die Aufgabe zu, das vorliegende Wissen ins Digitale so zu übersetzen, dass es für die junge, die un-alphabetische Generation, zugänglich bliebe. Sonst liefen wir Gefahr, dass »die Geschichte«, die Wahrnehmung von Geschichtlichem überhaupt, aus unserer Kultur verschwände.
Stützen kann man solche Behauptungen höchstens durch ein paar Beobachtungen, Selbstbeobachtungen und Wahrnehmungen sozialer Tendenzen. Meiner Beobachtung nach z. B. hängt die überall diagnostizierte Abneigung gegen das Lesen damit zusammen, dass große Teile der jungen Generation nicht mehr in der Lage sind, die Augen auszurichten auf den handschriftlichen oder gedruckten Zeilenfall einer Buchseite oder eines Blatts Papier. Man kann bei Schülern beobachten, dass sie, wenn sie einen Aufsatz schreiben sollen, es mit der Hand nicht hinbekommen, aber am Laptop: ja. Ihre Gedanken sind Laptop-kompatibel; Tastatur und Monitor des Laptop scheinen eine andere Art Buchstaben zur Verfügung zu stellen als die Connection Hirn, Auge, Hand, Schreibstift, Papier. Eine andere Sorte Raum, einen anderen Denkraum.
Ähnliches kann man beobachten am fulminanten Untergang des Geschichtsdenkens, des Denkens in zeitlichen geschichtlichen Abläufen bei der heutigen Schülergeneration. Es gelingt ihnen nicht, auch wenn sie das intensiv büffeln, das dritte oder vierte Jahrhundert v. u. Z., also etwa die Plato-Zeit, mit 300 oder 800 danach, mit Frühchristen, Völkerwanderung oder Karl dem Großen, oder mit dem 12. oder 17. Jhd. in irgendeine sinnvolle Relation zu bringen; abgesehen vielleicht von solchen Einschnitten wie der Entwicklung der Zentralperspektive in der Renaissance, das geht vielleicht noch gerade. Aber das Raster der Geschichte als der eines linearen Zeitverlaufs, die wir jetzt seit 3000 Jahren so geschrieben haben, oder, wenn wir wollen, ab etwa 10 000 vor, also mit Beginn der Haustierzüchtung, die so etwas wie eine menschlich-kulturelle Einschreibung in wilde Tierkörper ist, oder auch mit den Höhlenmalereien noch einige zehntausend Jahre früher – diese Linie stellt sich nicht mehr her bei den allermeisten. Sie haben kein Raster dafür, keine Speichermöglichkeit. Wenn sie Geschichtstests schreiben müssen, lernen sie die Kernfacts und vergessen sie gleich wieder. Weil die Daten nicht haften, weil die Zeit nicht als historische Sequenz, sondern wie im Fantasy-Roman in ihnen vorliegt, oder eben wie im Computer: als Gleichzeitigkeit aller Zeiten.
Wie auch alle literarischen Texte im Moment, in dem sie digital erfasst sind, im Computer eine Existenzform der Gleichzeitigkeit bekommen. Man kann in die Suchmaschine ein bestimmtes Wort eingeben, wie es z. B. bei Kafka auftaucht oder bei Schopenhauer, und bekommt alle Belegstellen; und man kann eingeben wie dies Wort oder ein philosophischer Begriff von den Griechen bis heute in verschiedenen Zusammenhängen erscheint, und man erhält in beiden Fällen einen vollkommen neuen Text, neue Kontexte, ungeahnte Querverbindungen mit neuen Denkanstößen; die Historizität dieses Einzelworts oder bestimmter philosophischer Begriffe verschwindet im anders strukturierten Meer des Digitalen. Solche Beobachtungen und Selbstbeobachtungen kann man anstellen, und man wird nicht wenige Wahrnehmungen machen, die Flussers so unwahrscheinlich klingende Behauptungen hier oder da plausibler werden lassen. Frage: sind solche technologisch indizierten Wahrnehmungsveränderungen tatsächlich in der Lage, die Synapsenschaltungen im Hirn so zu verändern, dass man von dauerhaften Veränderungen reden kann oder sind das Spekulationen ins Blaue, bzw. Graue, ins Leere. Und was steuert die neue Hirnforschung wirklich dazu bei.
Auf diesem Hintergrund läuft ab, was ich Ihnen nun vortrage. Über Übertragungen und über Gegen-Übertragungen, Zentralbegriffe in der psychoanalytischen Technik heute und natürlich Zentralbegriffe im Bereich des Sendens und Empfangens, z. B. von Musik. Mir geht es heute hier um die Darlegung eines Gedankens zu einer bestimmten Gleichheit oder Parallelität von psychoanalytischen Prozessen und Prozessen, die ablaufen bei der Herstellung von Kunst und beim Umgang mit Kunst. Übertragung ist ein Zentralbegriff nicht nur in der psychoanalytischen Technik; Übertragung ist auch (wenigstens im Deutschen) der Zentralbegriff im Bereich des Sendens und Empfangens, z. B. von Musik. Ich fange an bei der Übertragung (nicht: broadcasting) von Musik.
Klangkörper Mutterleib. In einem schönen Buch des Psychoanalytikers Sebastian Leikert zur Psychoanalyse der Musik gibt es folgenden Abriß der Bedeutung des Hörens für den Fötus, das werdende Kind im pränatalen Stadium. Die erste Besonderheit der Musik liegt darin, sagt Leikert, dass sie sich prinzipiell, anders als später die Wörter, »nicht auf gesehene Objekte (Objektvorstellungen), sondern auf erlebte Körperspannungen bezieht«. Der Körper des Fötus lebt in einer taktilen und er lebt in einer akustischen Welt. Die erste Umgrenzung des Selbstgefühls im Mutterleib ist laut Leikert eine »Lauthülle«. Sie gibt, noch vor der Erfahrung der Haut, dem Fötus ein erstes Konsistenzgefühl. »Ab dem vierten Monat der Schwangerschaft ist das Gehör als erstes Sinnesorgan voll ausgebildet und spielt eine wichtige Rolle in der Beziehung von Fötus und Mutter. In der Stimme gewinnt die Mutter für das ungeborene Kind die erste fassliche Gestalt, die Mutter ist für das Kind zunächst die Stimme«[2]. Das Ungeborene entwickelt eine Beziehung zu dieser Stimme als erstem »äußeren Objekt«. Zudem ist der auditive Kanal direkt mit den Körperabläufen verschaltet; das Gehör für die Innervation des Körpers zuständig: »Bestimmte Frequenzen sind für die Aktivierung der Hirnrinde und damit für den Körpertonus verantwortlich. Sowohl die psychische Aktivität als auch die Integration des Körpererlebens sind also mit der auditiven Beziehung eng verbunden«. Am Anfang des Denkens wie der körperlichen Bewegung ist also das Hören. Soweit Leikert.Der Fötus nimmt aber nicht nur die Stimme der Mutter wahr, er hört auch ihre Körpergeräusche, Darm, Pulsschlag, ihren Atemrhythmus, ihre Körperbewegung, die Rhythmik ihres Ganges. Die Mutterleibsgeräusche erreichen bis 84 Dezibel, das entspricht städtischem Straßenlärm. Ohne solche Gewöhnung würde das Baby nach der Geburt vermutlich an unerträglicher Lärmzufuhr sterben. Puls, Atem und Gang sind aber nicht nur körperliche Abläufe, sie finden sich parallel in den Abläufen von Musik. Das Ungeborene »versteht« Musik, weil sie die Physiologie des Mutterkörpers nachbildet. Weil sein eigenes Pulsieren mit dem Pulsieren des Körpers, der ihn umfängt, entsteht. Dem Herzrhythmus entspricht in der Musik das Metrum, der Beat; dem Atemrhythmus die Phrasierung und die Modulierung der Stücke. Während im Melodieverlauf und den Abläufen der Harmonik der ständige körperliche Wechselvorgang von Spannung und Entspannung wiederholt, bearbeitet, verändert, verschoben wird).[3]
Der Reiz der rhythmischen Verschiebungen, der Synkopierungen, besteht damit u. a. darin, vom »Mutterbeat« abzuweichen, eigene Wege entlangzustolpern. Jede Abweichung, jede Verzögerung des erwarteten Lustgefühls, ist ein Stück Körpererweiterung und später Welterweiterung, Erprobung eines neuen Terrains. Marschmusik (wie alle Musik, die den Viertelbeat mit Betonung auf eins und drei durchzieht) wäre von daher »kontraphobisch«; eine Selbstversicherung, nicht vom Herzschlag des Trägertiers verlassen zu sein. Körper, die auf Marsch- oder die entsprechend gebaute Schlagermusik abfahren, haben sehr wahrscheinlich ein Fötalstadium in Angst hinter sich. Und erleben den Simpelbeat nun als Versicherung gegen diese. Blühen also auf, fühlen sich angstfrei und »legen los«. (Vorsicht geboten. [4])
Wobei nicht eine bestimmte Musikart entscheidend ist für die Auslösung bestimmter Körpergefühle des geborenen Kindes oder der erwachsenen Person. Entscheidend sind die Affekte, die die Mutter erlebt hat bei einer bestimmten Musik. Die Mutter überträgt diese Gefühle auf den Fötus. So ist die seit langem und immer wieder kolportierte Erzählung, dass Babys bei Mozartmusik leichter einschlafen und dann auch ruhiger schlafen würden als Babys bei Rock- oder Jazzmusik unzutreffend. Es kommt darauf an, welche Musik die Mutter während der Schwangerschaft gehört hat und mit welchen Gefühlen. Auch dieser Bereich der Reaktionsfortsetzung bzw. –differenz zwischen Fötus und Kleinkind ist inzwischen untersucht.[5] Ergebnis: Das Kind einer Harfenistin schläft leichter und ruhiger bei Harfenmusik. Sein Geschrei bei Unwohlsein kann mit Harfenmusik gestoppt werden. Während eine andere Musik sein Unwohlsein verstärkt. Während das Baby einer Mutter, die regelmäßig in der Disco war während der Schwangerschaft, von Harfenmusik nicht beruhigt wird. Im Gegenteil, es schreit stärker. Aber es schläft gut ein bei lauter Musik, die jener gleicht, die es als Fötus im Mutterleib gehört hat. Nicht nur gehört, sondern erlebt hat. Es wiederbelebt nach der Geburt die Gefühle, die die Mutter ihm übertrug bei Discokrach.
Als ständige Orientierung dient dabei dem Fötus die Stimme der Mutter, die, zusammen mit den Musiken, die da öfter klingen, die Kraft hat, dem Fötus und später dem Kleinkind als das »gute Objekt« im Sinne Melanie Kleins zu erscheinen. Als »gute, nährende Brust«, im Gegensatz zu verfolgenden Objekten, die demzufolge nicht nur aus der Abwesenheit der Mutterbrust, sondern auch der Mutterstimme sich ableiten. Abwesenheiten, die den Kleinkindkörper mit Zerrissenheitsgefühlen bedrohen. Durch die Abwesenheit der Stimme der Mutter können erste Erfahrungen bedrohlichen Objektverlusts sich ausbilden. Stimme und Musik verkörpern demnach wie nichts anderes die glückliche Beziehung zum guten Objekt; Beziehung zum »guten Objekt«, noch bevor dieses selbst sich als ganze Person in der Wahrnehmung des Kleinkinds ausgebildet haben muß: die Anwesenheit von Stimme und Musik als glückhafter Zustand, als Gleichgewicht, als Leichtigkeit, als Abwesenheit von Verfolgung.[6] Musik führt immer etwas mit sich, zumindest die glücklichen Momente eines frühen Gehaltenseins, wenn es sie gab.[7]
Leikert zitiert in dem Zusammenhang einen weitreichenden Gedanken Suzanne Maiellos zum Spracherwerb des Kleinkindes bei Abwesenheit der Mutterstimme. Sollte diese Abwesenheit, aus welchen Gründen immer, eingetreten sein, könne dies den Spracherwerb des Kindes befeuern, indem die Stimme des Kindes selber versucht, die entstandene Leere zu füllen: »eine Erfahrung von einem entleerten Raum, in dem sich später das Denken entwickelt sowie die Sprache, die das verlorene Objekt re-evozieren, d. h., ihm „die Stimme zurückgeben“ kann«. »Der spätere Spracherwerb dient dann der Restitution dieses verlorenen Objekts«.[8] Die frühe Entwicklung von Gesangsfähigkeiten beim Kleinkind könnte dann umso mehr diese Funktion erfüllen. Die eigene Stimme als »gutes Objekt«, wie sie ja im onomatopoetischen Gesang – das ist dieses glückliche, wortlose Gebrabbel und Juchzen der Kleinkinder in der Wiege – sehr genau wahrzunehmen ist, könnte sich entfalten als Versicherung gegen eine befürchtete oder tatsächliche Abwesenheit der Mutterstimme.
Musik ersetzt aber nicht nur, sie tut mehr: sie verspricht die Fortsetzung der Erfahrung der Anwesenheit des guten Objekts auch unter den sich verändernden Bedingungen des In-der-Welt-Seins in späteren Lebensphasen. Zwischen dem Adoleszenten und den neuen Objekten der Außenwelt kommt es zu immer neuen Übertragungen; und Musik ist ein Leitmedium dieser Explorationen; für manche Kinder das Leitmedium.
Körperspeicher. Auch nach den Forschungen des Musikologen und Hirnforschers Robert Jourdain, Das wohltemperierte Gehirn. Wie Musik im Kopf entsteht und wirkt,[9] sind alle erlebten frühen Körperspannungen verbunden mit Tönen, mit Musik. Der Körper schwingt mit beim Empfang musikalischer Schwingungen. So wie der Körper des Instruments durch sein Mitschwingen den Ton der Saite erst richtig hörbar macht, sagt Jourdain, so ähnlich »nutzen wir unseren Körper als „Resonator“ für auditorische Erfahrungen. Der Zuhörer selbst wird zum Instrument, er legt seinen Körper in die Hände der Musik und läßt diese auf ihm spielen«. Jourdain: »Interessanterweise beruht ein neuerer Trend in der Emotionstheorie auf der Idee körperlicher Repräsentationen kognitiver Prozesse. Diese Hypothese der somatischen Marker, die Antonio Damasio erst vor kurzem in seinem Buch Descartes’ Irrtum populär machte, geht davon aus, daß das Gehirn auf alle Arten von Erfahrungen mit angenehmen oder unangenehmen körperlichen Reaktionen antwortet.«
Seit ich in psychoanalytischen Zusammenhängen wahrnehme und denke, habe ich immer wieder behauptet, »der Körper« speichere; gestützt auf Selbstbeobachtung, auf Züge im »automatisierten« motorischen Verhalten soldatischer Männer, körper-reiz-gesteuert, und unterstützt von einigen Filmkritikern und französischen Analytikern, die Ähnliches wahrnahmen, aber ohne wirklichen Beweis. Die Formulierungen von Jourdain kommen in die Nähe eines solchen Beweises. Der Körper vergisst die musikalischen Enervierungen nicht, schreibt er, er bewahrt sie. Der Körper speichert musikalische Erfahrungen ab. »Wir benutzen unsere Muskeln anscheinend zur Repräsentation von Musik, wir ahmen die wichtigsten Eigenschaften musikalischer Muster durch kleine und große Bewegungen nach«. Jeder musikalische Reiz löst einen Körperreflex aus und der Körper speichert diesen Reiz.[10]
Nicht nur das Gehirn also reagiert, indem es bei Musikgenuß die opiatähnlichen Endorphine ausschüttet; auch der Körper reagiert; die Muskulatur ist eine Registratur auditiver Lüste (und Schrecken). Die Töne haben ihren körperlichen Niederschlag. Jourdain: »Musik scheint von allen Künsten die zu sein, die uns am unmittelbarsten berührt, und ist daher auch die, die am leichtesten Ekstase hervorruft«. Beim Versuch, Ekstase genauer zu beschreiben, unterlaufen ihm dann interessante Wörter: »Ekstase verwischt die Grenzen unseres Seins, enthüllt uns die Bindungen zur Außenwelt und läßt uns in ein Meer von Gefühlen eintauchen«. Auflösung der Körpergrenzen, »eintauchen« in ein Medium, das er ein »Meer aus Gefühlen« nennt. Und dann: »Ekstase ist eine momentane Transformation der Person, die sie erlebt, nicht nur eine Transformation ihrer Erfahrung«. Transformation der Person – das ist der zweite Punkt, um den es mir hier geht; um die Frage, inwieweit die Psychoanalyse und die verschiedenen Künste in womöglich gleicher Weise an ihr arbeiten.
Medium im Raum. 3. Körper. Es war die Beschreibung einer analytischen Situation als medialer Situation von D. W. Winnicott, die mich zu der Formulierung von einem 3. Körper verführte. In seinem Kapitel „Zustände von Entrückung und Regression“ berichtet D. W. Winnicott (1958) von einem Analysanden mit besonderen Abwesenheitszuständen.
»Wie so viele Patienten, versinkt auch dieser gelegentlich tief in die analytische Situation, und bei einigen wenigen, aber wichtigen Malen geriet er in einen Zustand der Entrückung. Während dieser Momente der Entrücktheit geschehen unerwartete Dinge, die er manchmal erzählen kann«<. Winnicott notiert:
»In einem momentanen Zustand der Entrückung hatte der Patient das Gefühl, während er sich wie gewöhnlich auf die Couch legte, er sei zusammengekrümmt und rolle über das Couchende hinunter«. (…) »Als er davon sprach, dass er zusammengerollt gelegen hätte, deutete er mit Handbewegungen an, wie er sich in diesem seinem zusammengerollten Zustand irgendwie im Raume vor seinem Gesicht befunden und sich umherbewegt habe. Ich sagte darauf sofort: “Wenn Sie davon sprechen, dass sie zusammengerollt waren und sich umherbewegten, so setzt das doch etwas voraus, das Sie nicht beschreiben, da Sie sich dessen nicht bewusst sind, es setzt doch das Vorhandenseins eines Mediums voraus“. Nach einer Weile fragte ich ihn, ob er verstanden hätte, was ich meinte, aber ich merkte, dass er es sogleich verstanden hatte. Er sagte: „Ja, so wie die Kugeln im Öl des Kugellagers“«.[11]
Dieser Patient fällt in eine Entrückung, um ein tragendes Medium im Raum zu erzeugen: Öl, Atem, Gedanken. Er wünscht, der Analytiker möge ihm in diesem Medium entgegenkommen. Ein Moment, das Winnicott auch gern mit dem Wort Containing bezeichnet.
Ein andermal ist es ein Kopfschmerz des Patienten, der merkwürdigerweise außen sitzt. Winnicott deutet, da der Schmerz dicht außen am Kopf sitze, er repräsentiere das Bedürfnis, dass jemand Ihm den Kopf halte, so wie man es bei einem Kinde tut, das sich in einem Zustand tiefer emotionaler Betrübnis befindet. Wieder geht es um eine Art Überbrückung des Raumes zwischen ihnen.
Winnicott: »Ich verknüpfte nun meine Deutung mit jener Schlüsseldeutung von dem schützenden Medium (…) Er berichtete, dass er in einem Moment der Entrückung das Gefühl gehabt hätte, ich besäße eine Maschine, die ich anstellen könnte und die Vorrichtungen für eine Art von Sympathie-Behandlung hätte«.
Ein realer Gegenstand also zur Herstellung einer Verdickung oder Verdichtung der Raumatmosphäre; ein Maschinchen, das den Raum zwischen Analytiker und Analysand auf Knopfdruck anfüllt mit dem benötigten tragenden Medium »Verständnis« oder »Sympathie«.
Diese Beschreibung Winnicotts geht für mein Gefühl weit über die Darstellung jenes Zustand hinaus, unter dem Winnicott die Sache schließlich theoretisch abhandelt: eine bestimmte Sorte Regression ‑ gut nutzbar zu machen für die Analyse, wenn der Analytiker den Moment ihres Eintritts nicht verpaßt. In Winnicotts Satz »Die Hauptsache war, dass ich sofort verstand, was er brauchte«, liegt aber weit mehr und auch anderes. Denn dieser Patient brauchte nicht so sehr Deutungen regressiver Zustände, er brauchte die Wahrnehmung einer medialen Füllung des Raums zwischen Analytiker und ihm, hergestellt in einer gemeinsamen Produktion. Im Zusammenhang mit diesem Medium im Raum fällt das Wort »Übertragung«. Es geht um etwas drittes Körperhaftes, eine Art dritter Körper, der keine Imagination ist, kein eingebildetes Wesen, sondern etwas materiell Anwesendes, das beide spüren und zu dessen Existenz beide etwas beigetragen haben.
Momentane Transformation der Person, mediale Verdichtung im Raum, Entrückung in der analytischen Übertragung, oder Ekstase, ausgelöst durch Musik, die nach Speicherorten im Körper suchen und ihn, laut Jourdain auch finden – werfen ein neues Licht: Im Buch der Könige 1 habe ich die merkwürdige Erfahrung beschrieben, dass Schallplatten, die man Jahre später wieder hört, dem emotionalisierten Hörer den Eindruck vermitteln, sie hätten in ihren Rillen die Gefühle gespeichert, die man vor Jahren beim ersten Hören hatte. Die Gefühle und die Situationen, aus denen sie kamen. Ich schrieb dort: »Auf manchen Mingus-Platten, bei Coltrane oder Billie Holiday, in Sun Ra’s Heliocentric Worlds, in einigen Klavierkonzerten Mozarts, in vielen Rockstücken, auf Dylan-Platten, auf vielen anderen, sind bestimmte Gefühle, die ich beim Hören hatte, derart genau gespeichert, dass ich nicht zufrieden bin, das einfach „Erinnerungen“ zu nennen. Auch nicht ein Hilfsmittel zur Wiederbelebung. Die Platten haben etwas aufgezeichnet, während sie liefen; nicht nur etwas abgespielt«. (377) Rein »technisch« ist das natürlich Quatsch. Die Nadel selber gräbt nichts Neues in die Rillen. Merkwürdigerweise stoße ich aber auf wenig Widerstand, wenn ich diese Wahrnehmung äußere. Im Gegenteil: andere Menschen, für die bestimmte Musiken in bestimmten Lebensmomenten besonders wichtig waren, scheinen das Gleiche zu empfinden. Die offenkundige Irrationalität der Aussage stört sie nicht. Ihr Gefühl, dass das »irgendwie stimmt« ist stärker. Was ist denn nun dran?
Zieht man Robert Jourdains Befund vom speichernden Körper hinzu, ergäbe sich, dass bei späterem Hören, dass bei erneuerter Übertragung, wenn sie stark genug ist, die aufgerufenen muskulären Areale ihr Gespeichertes »öffnen«, ihren Reiz ins limbische System zurücksenden und dieses die Wahrnehmungen »abruft«, die mit dem früheren Hören verbunden waren. Weitergeschickt zum Cortex erscheinen sie uns dann als exakte »Erinnerungen«, Bilder, Gesichter, Gerüche, Orte, Konstellationen und »das Herzzerreißende« ‑ die Wiederbelebung scheinbar untergegangener Gefühle.
Use it, or loose it. Übertragen wird zwischen Geräten und Menschen, Geräten und Geräten, Menschen und Menschen, Gedanken werden übertragen und Krankheiten. Aufgaben und Ämter. Neue Fähigkeiten, die Menschen irgendwo erwerben, »übertragen« sich auf merkwürdige Weisen. Eine Stimmung überträgt sich. Und Musik überträgt sich in den Körper und wird gespeichert in offenbar speziell dafür vorgesehenen Hirn- und Muskelarealen. Ich glaube, dass mit noch einigen weiteren Feststellungen neuerer Hirnforschung sich ein tatsächlich weiterführender Zugang zu den angesprochenen Phänomenen ergibt.Da ist an erster Stelle die permanente Veränderbarkeit unserer Hirnstrukturen – Fachwort: Synapsenverschaltungen – bedingt durch den Wechsel unserer Tätigkeiten und die wechselnden Erfahrungen unseres Beziehungslebens, wie besonders Joachim Bauer in seinem Buch Das Gedächtnis des Körpers immer wieder betont. Bauer: »Hätten wir die Möglichkeit, einmal im Jahr eine Reise in unser Gehirn zu machen und uns dort mit einem Elektronenmikroskop umzusehen, würden wir erheblich verändert „Landschaften“ entdecken. Der Grund dafür ist, dass Ereignisse, Erlebnisse und Lebensstile die Aktivität von Genen steuern und im Gehirn Strukturen verändern«. (7) Nicht also: die Gene steuern unser Verhalten, wie es die panischen Boulevard-Versionen wollen. Bauer: »Erst in jüngster Zeit wurde außerdem entdeckt, dass individuelle Erfahrungen im Organismus Reaktionsmuster ausbilden können, die einen Einfluß auf die Regulation der Genaktivität in zukünftigen Situationen haben. Es wurde experimentell gezeigt, dass bestimmte genetische Reaktionsmuster durch Erlebnisse und Erfahrungen „eingestellt“ werden können«.(9) Joachim Bauer zitiert Leon Eisenberg, der bündig von der »sozialen Konstruktion des menschlichen Gehirns« spricht.[12] (Bauer, 16)
Grundregel Nr. 1 zur Wahrnehmungstätigkeit laut Bauer: Bioelektrische Aktivierung verstärkt die synaptischen Verknüpfungen im Hirn. Auf eine Formel gebracht (natürlich von Amerikanern): Cells that fire together wire together. »Fire«, Feuern, nennt man das Aussenden bioelektrischer Signale der Neurone. Was zusammen feuert, verkabelt sich auch zusammen. Grundregel Nr. 2: Synapsen, die nicht aktiviert werden, verlieren ihre Relevanz, lösen sich auf, schwächeln, verschwinden. Amerikanische Formel: Use it or lose it. Was nicht benutzt wird, schläft ein. »Die grundlegende Fähigkeit des Gehirns, durch sein Tätigwerden seine synaptischen Verschaltungen zu verändern und damit seine eigene Feinstruktur umzubauen, wird als „synaptische Plastizität“ bezeichnet«. (Bauer, 78)
Der Bremer Neurobiologe Gerhard Roth, der in ähnlicher Weise Kompendien des laufenden Stands der Hirnforschungen erstellt, spricht in die gleiche Richtung. Er dokumentiert dabei eine bemerkenswerte Kehrtwendung, die Neurologen und Neurobiologen im Lauf des letzten Jahrzehnts vollzogen haben; nämlich eine sehr weitgehende Rehabilitierung der meisten Grundannahmen Freuds zum »psychischen Apparat«, die noch in den 80er und 90er Jahren von Hirnforschern überwiegend als Humbug verlacht wurden bzw. als »Voodoo«. Besonders die Annahme unbewußter determinierender Prozesse sieht Roth als neurobiologisch erwiesen an. All dies erfülle die Hoffnungen Freuds, »eine „Lokalisation der seelischen Vorgänge“ zu erreichen«, etwa »„den anatomischen Ort des Systems Bw, der bewußten Seelentätigkeit, in der Hirnrinde zu erkennen und die unbewußten Vorgänge in die subkortikalen Hirnpartien zu versetzen“«[13] (433)
Subcortex – limbische Zentren – Amygdala: für die Hirnforscher ist es ausgemacht, daß diese die neuronalen Schauplätze aller unbewußten Vorgänge sind. Während das Bewußtsein in der Hirnrinde, im Cortex entsteht, ein Produkt der andersgearteten Zellen des Cortex ist. Bewußtes und Unbewußtes arbeiten in je verschiedenen Zellstrukturen. Ein einfacher Übergang aus der einen in die andere Zellstruktur ist nicht möglich. Es gibt also eine handfeste histologische Begründung für die Annahme Freuds, unbewußte Inhalte seien letztendlich nie bewußtseinsfähig; wörtlich: »daß die unbewußte Vorstellung als solche überhaupt unfähig ist, ins Vorbewußte einzutreten, und daß sie dort nur eine Wirkung zu äußern vermag, indem sie sich mit einer harmlosen, dem Vorbewußten bereits angehörenden Vorstellung in Verbindung setzt, auf sie ihre Intensität überträgt und sich von ihr decken läßt«. (Traumdeutung, 568)
Verbunden sind die beiden Systeme nur durch eine Energiemenge; durch die Übertragung dieser Energiemenge von einem Hirnareal in ein anderes ergeben sich Zugänge. Die Arbeit des Analytikers bestünde demnach darin, den Weg solcher energetischer Übertragungen zurückzuverfolgen; zu erspüren (oder zu hören), welche Leerstelle, welche traumatisierte Position im Unbewußten des Patienten sich in seinen Äußerungen zu Gehör bringen will. Die Wahrnehmung davon, die sich im Analytiker vollzieht, – Gegenübertragung, projektive Identifikation oder Ähnliches – wäre materiell zu beschreiben als die Rück-Übertragung eines Energiequantums von einer Zellstruktur (Cortex) in eine andere Zellstruktur (limbisches System), bei gleichzeitigem Erspüren der geschichtlichen Konstellation, die diese Energieübertragung im Patienten ausgelöst hat.[14]
Das »dritte Subjekt«. Wie aber soll dies passieren? Wie »verwandelt« sich der Analytiker in ein Wesen, das in seiner eigenen zerebralen Zellstruktur der Zellstruktur des Unbewußten des Pat. so nahe kommt, daß er nicht nur dessen Energiequantum erspürt – oder auffängt wie ein Radioempfänger die gesendeten Wellen – sondern diese gesendeten Wellen auch umwandeln kann in eine andere Daseins- bzw. Zellform: in eine gesprochene Deutung, in ein Bild, das er dem Patienten darbietet; in das Erspüren einer geschichtlichen Konstellation, die er dem Pat. gegenüber aussprechen oder andeuten kann oder sie so antippen, umschreiben und aufbereiten, daß der Pat. selber eine Äußerungsform dafür findet.
Ich kann ja nun – wenn ich vom 3. Körper spreche – schwerlich behaupten, daß die Zellstrukturen beider Amygdalas aus ihrem je eigenen Schädel auswandern und sich im Raum, knapp über dem Teppich, treffen, um eine neue Gesamt-Amygdala zu bilden – eine mystisch-phantastische Gestalt, die in der Lage wäre, die Substrate des Unbewußten aller beider derart zu vermischen und zu verbinden, daß ein Austausch, ein gegenseitiges Erleben der Struktur des Unbewußten des jeweils anderen, im Analytikerzimmer nicht nur magisch, sondern körperlich-materiell stattfände. Und wenn ich es behauptete – wer würde mir glauben?
Hilfe kommt vom amerikanischen Analytiker Thomas Ogden. Ogden entwickelte die Idee, »dass die Träume und Träumereien, die Analytiker und Patienten in jenem Zwischenreich des Träumens schaffen (…) unbewusste Erlebnisse umfassen, die das analytische Paar gemeinsam (…) konstruiert. Diese unbewusste intersubjektive Konstruktion, die ich den analytischen Dritten genannt habe, ist ‚das Subjekt der Analyse’: ein drittes Subjekt mit einem Eigenleben, vom analytischen Paar gemeinsam geschaffen (…) Und in der Tat können wir unsere Träume nicht mehr als ausschließlich uns eigen verstehen«; vielmehr als »Träume des gemeinsam, aber asymmetrisch konstruierten Dritten«.(17) Ganz besonders gilt das für die überfallartig einsetzenden Tagträumereien und Abschweifungen der Aufmerksamkeit, die sowohl Analytiker wie Analysanden aus dem gegenwärtigen Moment heraustragen; aber nicht etwa hinweg, sondern näher zum anderen hin: ganz ähnlich dem, was Winnicott Entrückungen nannte. All jene »Gefühle, Phantasien, Grübeleien, Tagträume, Körperempfindungen (…) von denen wir gewöhnlich annehmen, dass sie mit dem, was der Patient im betreffenden Augenblick sagt und tut, nicht das Geringste zu tun haben«, (26) versteht Ogden als Zeichen für Zustände neu entstehender Nähe zwischen beiden. »Durch das Erleben des analytischen Dritten entsteht eine Erfahrungsgrundlage, ein Fundus unbewussten Erlebens, zu dem Analytiker und Analysand gleichermaßen beitragen und auf den sie in ihrem Erleben der analytischen Beziehung als Einzelne zurückgreifen können«.(25)
Dazu trägt Ogdens Buch Gespräche im Zwischenreich des Träumens den Untertitel: Der analytische Dritte in Träumen, Dichtung und analytischer Literatur. Im Buch spielt sich das so ab, dass ein Kapitel mit einer Falldarstellung auf ein Kapitel über den Umgang mit einigen Gedichten folgt; mit dem Schluss, dass es sich strukturell genau gleiche, was sich zwischen Ogden und einem Gedicht von Robert Frost und zwischen Ogden und seiner Patientin Frau S. in der Analyse abspielt. »Das Gedicht erzeugt ebenso wie die analytische Sitzung starke Resonanzen von Klang und Bedeutung«, sagt Ogden. (96) Und er setzt fort, »…dass ein Lebendigsein im Zwischenreich des Träumens nicht nur eine Kunst ist, sondern das Lebensblut aller Kunst. (19) So direkt hat noch kein Analytiker die Arbeit der Analyse mit der Annäherung an ein Gedicht gleichgesetzt. Und beide erzeugen zwischen sich eher tranceartig das »dritte Subjekt der Analyse«.
Die Konfiguration, die ich den »dritten Körper« nenne, wäre demnach, wie ich ja unterstelle, nicht beschränkt auf die analytische Situation; auf das Zusammentreffen der mächtig sendenden Amygdala-Strukturen im Raum, wenn beide die medialen Vorraussetzungen dafür geschaffen haben: die Verdichtung im Raum derart zu konzentrieren, daß die Empfindung eines tragenden, umgebenden Mediums wie bei Winnicotts Patient entstehen kann. Sie entstünde in allen Fällen, wo es darum geht, daß die Beteiligten über sich hinaus wollen, aus sich heraus wollen, auf eine Ebene neuer Erfahrungen wollen, wofür sie ein Vehikel brauchen: den »dritten Körper«; dessen Erzeugung in diesem Metamorphosenspiel dann eher eine transgressive als eine regressive Tätigkeit sein muss.
Emotionaler Aufruhr. Für solche Transformationszustände in den neuronalen Systemen befindet Roth, dass sie niemals »ausschließlich sprachlich« geschehen, »sondern nur in Verbindung mit der Erzeugung eines »emotionalen Aufruhrs, der auf das Unbewußte eines Patienten einwirkt«. Als mögliche Auslöser dieses emotionalen Aufruhrs nennt Roth Meditation, Drogen und Liebe. Eher störend in einer Psychoanalyse sei die zwangsläufige Beschränktheit auf das rein Sprachliche, besonders der »fatale Deutungszirkel«, in dem sich der Patient einer Analyse, ich-gesteuert, oft befindet. Anders der Analytiker: »Er hat einen parallelen Zugang zu den bewussten Äußerungen des Patienten und zu den Äußerungen des Unbewußten in Fehlleistungen, Träumen, Neurosen und Psychosen, und er kann in geduldiger therapeutischer Tätigkeit versuchen, die unbewußten psychischen Konflikte aufzudecken«. Daß dies nicht als simple Umsetzung geht, als das, was man relativ gedankenlos »Bewusstmachung« nennt, wird von Roth aus der differenten Struktur von Gehirnzellen begründet: »Die Amygdala und die anderen limbischen Zentren verstehen Sprache als rein kognitives Kommunikationsereignis nicht, sondern nur die mit ihnen verbundenen emotionalen Komponenten wie Prosodie, Mimik und Gestik, oder sprachlich ausgelöste emotionale Zustände wie bildliche Erinnerungen oder Vorstellungen. Diese Emotionen können dann Veränderungen subcortikaler limbischer Zentren auslösen, zum Beispiel die gesteigerte Ausschüttung bestimmter Neuromodulatoren und Neuropeptide«. (438f)
Was derart von Roth neurobiologisch formuliert wird, erscheint beim Analytiker Thomas Ogden als unaufhörliches Kreisen seines Schreibens um die Empfehlung, »beim sprachlichen Ausdruck auf das Empfinden von Lebendigkeit oder Leblosigkeit zu achten«. (48) Es ginge in der Analyse weniger um Aufdecken und Deuten, als um das Erspüren der Übertragungs- und Gegenübertragungsvorgänge um jenes Gebilde herum, das er »das dritte Subjekt« der Analyse nennt; und dessen Konsistenz er hartnäckig mit jenem Gebilde gleichsetzt, dass zwischen ihm und einem Gedicht entsteht, das er liebt; bei der körperlichen Aufnahme (nicht: Lektüre) von Gedichten wie Robert Frosts Aquainted with the Night. Wie es im Gedicht Zeilen gibt, die sich reimen, sagt Ogden, gibt es in der Analyse die Momente, wo Patient und Analytiker sich »aufeinander reimen«; in eben diesem dritten Gebilde zwischen ihnen, dessen Erscheinen man nicht verpassen dürfe.
In diesem Kontext würde ich zu Roths Dreiergruppe Meditation, Drogen und Liebe die Zustände intensiver Freundschaft hinzufügen; sowie all die Zustände von Berührung und Vermischung mit erregenden Produktionen der verschiedenen Künste, Musik, Malerei, Filmen, Literatur. U. U. auch die Zustände von Auflösung gepanzerter Körperstrukturen durch besondere sportliche Anstrengungen. In allen Fällen geht es um körperliche Ausnahmezustände.
Medium Musik: ein dritter Körper entsteht ganz spürbar im Raum bei mir besonders durch elektrifizierte Musik, verschiedenste Formen des Rock und des Free Jazz, Sun Ra, Art Ensemble of Chicago. Bei anderen mag es Beethoven sein. Ein Teil des eigenen Unbewußten wandert aus in den Raum, in den dort schwingenden 3. Körper, und trifft sich mit dem Wellenkörper der Musik, die auch ihr »Unbewusstes« hat, das nicht etwa aus irgendwie »unbestimmten, vagen Wünschen« besteht, sondern – für den, der sich mit der Musik auskennt – ziemlich exakt anzugeben ist.Die Wünsche und Vorstellungen, die eine Musik transportiert, setzen sich sehr genau fest in der Empfindung des Hörers. Wenn ich mir das, was sich zwischen der Musik (die in diesem Falle der „Therapeut“ ist) und meinem Körper abspielt, bewusst mache, ist es genau jene Umwandlungsarbeit, von der Psychoanalytiker wie auch Hirnforscher sprechen. In meinem Bewußtsein werden aus der Musik Formen von Nicht-Musik: Gedanken, Einsichten, Vorstellungen, Wünsche. Die primäre körperliche Sensationierung selber, die die Musik mit mir vornimmt – indem sie aus dem meinen und dem ihren einen dritten Körper bildet – wird nicht verbalisiert und ist auch nicht verbalisierbar. Sie lebt im Körper als gespeicherte Schwingung. Sie wird etwas anderes, wenn ich sie mit meinem Bewußtsein verarbeite. Ich wandle dann die Mikrozellen der Musik, die sich mit den Mikrozellen meines unbewußten Systems verbunden haben, um in neue Zellkombinationen meines Cortex. Darüber hinaus bewahre ich etwas im Körper, im ganzen sensomotorischen System, das als Ergebnis des Zusammenpralls mit der Musik sein Eigenleben führt. Das ist für mich das Entscheidende in einem materiellen Sinn: bestimmte Teile der Zellstruktur meines Körpers haben sich verändert nach der Aufnahme bestimmter Musiken. Ich reagiere anders; nicht nur anders auf bestimmte Musiken; auch anders auf bestimmte Leute und anders auf die Zustände des Wirklichen überhaupt, mit denen ich zu tun habe.
Die Stimme. In einem weitreichenden Abschnitt mit der Überschrift „Die Verschränkung der Stimmen im analytischen Gespräch“ untersucht Sebastian Leikert in seinem Buch zur Psychoanalyse der Musik die Stimmen der Beteiligten unter dem Aspekt ihrer Objekthaftigkeit: »Die Stimme des Analysanden sucht die Stimme des Analytikers in die Präsenz zu rufen. Nicht um die Bedeutung zu affirmieren, sondern um sich seiner Anwesenheit zu versichern. Seine Gegenwart ist Anhalt der Hoffnung auf eine nicht erneut traumatische Wiederholung des unbewußten Szenarios«.[15]Dann folgt eine Formulierung, die an einen Ringkampf der Stimmen denken lässt: »Jeder Analytiker kennt die Belagerung seiner Subjektivität durch den Ansturm der Stimme des Analysanden, er kennt jedoch auch das Gewicht, das seiner Stimme jenseits der manifesten Aussage zukommt. Er wird dem Gebrauch seiner Stimme eine besondere Bedeutung für den analytischen Prozess zuerkennen«.
»Belagerung« also. Und dann Invasion. Leikert: »In der Analyse geht es um den Versuch, das Gewicht des Traumatischen zu begrenzen.[16] Die Angestrengtheit des Analytikers beruht auf der Wirkung der invasiven Präsenz der Stimme des Analysanden im Körper des Analytikers«. Die Stimme dringt ein und der Analytiker muß sich ihrer erwehren.
Wenn man dies mit Winnicott verbindet, ergibt sich: Was im Raum zwischen den beiden passiert, in einer akustischen Situation, ist die Herstellung einer Präsenz von Stimm-Körpern, die durch ihre verdichtete Anwesenheit die Wiederholung des Traumatischen ausschließen. Leikert: »Die analytische Situation kehrt das „Primat des Optischen und der Vorrangigkeit des Visuellen“ zu Gunsten der ursprünglichen „Vorrangigkeit des Akustischen“ um (Ruhs 1999). Die Stimme wird zur Stütze, zum Rahmen und zum Zeichen der Anwesenheit des Anderen. Der Körper bezieht sich auf die Stimme, wie die Stimme sich auf den Körper bezieht«.
Diese Wahrnehmung wird bestätigt und verstärkt vom New Yorker Psychoanalytiker Steven H. Knoblauch. Knoblauch berichtet in seinen Falldarstellungen, wie er seine eigene Stimmlage absichtsvoll verändert und an die Stimmlagen der Analysanden anpasst, indem er in bestimmten Momenten »die Bässe aus seiner Stimme nimmt«; oder die Stimme singsangartig höher schraubt, um den Patienten in »ihre Tonlage« zu folgen. Der Psychoanalytiker Knoblauch ist auch Musiker, Jazzmusiker. Und formuliert genau die Wahrnehmung, auf die es mir im Kern ankommt. Er sagt, aus seiner Erfahrung als Analytiker und als Musiker, die Analyse funktioniere genauso wie eine Jazzimprovisation zwischen zwei Instrumentalisten. Aus dem jeweiligen Zusammenspiel entstehe das Dritte: das Musikstück bzw. der in der Analyse transformierte Körper des Analysanden und des Analytikers. Sowohl Knoblauch wie Ogden sprechen in dieser Hinsicht vom »analytischen Paar«.
Wenn Sebastian Leikert, der sich sowohl auf Ogden wie auf Knoblauch bezieht, formuliert: »Die Stimme als Objekt des Begehrens ist Motor der Übertragungsbeziehung«, heißt das, das Senden der Amygdalas allein würde nicht reichen. Auch das Schweigen ist nie nur Schweigen; die Stille nie nur Stille.[17] Es gibt etwas Objekthaftes zwischen den Polen. Die Stimme als das Medium im Raum, das den Anderen nicht zu Boden stürzen lässt; das ihn bewahrt vor der Körperzerreißung – ob in der analytischen Situation oder im eigenen Zimmer, in dem man sich, liegend oder tanzend, von einer Musik überschwemmen lässt. Seine Körpergrenzen von einer Musik austesten lässt, oder auch: sich einen neuen Körper übertragen lässt, den man nur empfangen kann, wenn man ihm in »emotionalem Aufruhr« entgegenwächst. Dies ist das Wort, das ich eigentlich suche, Entgegenwachsen.
Dies Alles zusammengenommen, von der Psychoanalyse des Pränatalen und des Kleinkinds, Winnicotts Wahrnehmungen von der Medialität der Übertragungen (wohl ein Ableger der Übergangsobjekte), die praktische Beackerung dieses Felds durch Elektro-Pop, die Zellexplorationen der jüngsten Hirnforschung und die Verschlingungsakte des Lacanianers Leikert mit »der Stimme«, ergibt schon einen ganz ordentlichen Berg Bausteine zu einer neuen Theorie der Musik[18] und eines erweiterten Verständnisses der Übertragungen.
Frequenzen des Unbewußten. Die Vorstellung, dass eine Psychoanalyse dauerhaft die Verschaltung von Hirnstrukturen verändern kann – eine brennende Idee, die Freud verfolgte – hat heute den Rang eines neurologisch belegten Faktums. Eine Veränderung, in deren Zentrum der Neurobiologe Roth den »Prozess von Übertragung und Gegenübertragung« sieht.[19] Hierzu, und zur Verbindung dieser Vorgänge mit Schwingungsprozessen, hat die Hirnforschung auch noch was zu sagen. Joachim Bauer:»Die an einer momentanen Wahrnehmung oder Vorstellung beteiligten Nervenzell-Netzwerke befinden sich – im Moment der gemeinsamen Aktion – in einer zeitgleichen (simultanen) phasengleichen (synchronen), rhythmischen bioelektrischen Aktivität, zu der sie sich über ihre Verbindungen anregen. Die Frequenz dieser bioelektrischen Aktivität liegt bei etwa 40 Hertz (40 Schwingungen pro Sekunde). Synchronisation, also Gleichzeitigkeit und Phasengleichheit der Aktivität, sind somit das „Bindemittel und Ordnungsmerkmal“ der Gehirntätigkeit, wie es der Frankfurter Hirnforscher Wolf Singer ausdrückte, der an der bahnbrechenden Entdeckung dieses Mechanismus führend beteiligt war«. (Das Gedächtnis des Körpers, 76f.)
Simultan, synchron, rhythmisch auf einer Schwingungsfrequenz von 40 Hertz arbeiten die Nervenzell-Netzwerke bei ihren Verschaltungen. Ein tiefer Basston – machte man ihn hörbar. Könnte sehr wohl sein, dass dies die Frequenz und Modalität ist, auf der der dritte Körper schwingt im aufgeladenen Raum. Sollte Körper eine zu gravierende Bezeichnung dafür sein, könnte man auch sagen »drittes Objekt« oder vielleicht – am genauesten – Schwingungsobjekt, in Anlehnung an Winnicotts Übergangsobjekte. Leikert z. B. kritisiert Ogdens »3. Subjekt« als zu sehr einem Personenstatus ähnelnd. Mit »3. Körper« kann er sich anfreunden. Schwingungsobjekt wäre die neutralste Bezeichnung.
Deutungen? No. Parallelisiert mit der Analyse wie Knoblauch sie beschreibt, würde das heißen: die improvisierte Musik der Stimme des Analytikers wird »körperlich« im Patienten; im Durchgang durch das dritte Objekt im Raum; den dritten Körper oder das Schwingungsobjekt, das beide gemeinsam erzeugen.Eine psychoanalytische Deutungsmethode von Kunstwerken gäbe es demnach prinzipiell nicht. Analyse und Kunst arbeiteten in Parallelvorgängen.
In der Parallelität von Übertragungsvorgängen psychoanalytisch und technisch/medial könnte auch eine Antwort liegen auf die Frage, warum Künstler sich so relativ selten auf analytischen Couchen einfinden. Sie arbeiten in Übertragungsvorgängen mit ihrem Material, ihren jeweiligen Medien. Durchgang durch „dritte Körper“ ist Teil ihrer Kunstproduktion. Sie stehen in einer Art Konkurrenzverhältnis zur Arbeit des Analytikers „am Material“. Ihr oft geäußertes Gefühl, der Analytiker habe ihnen dazu nichts zu sagen, ist zutreffend, soweit es die Materialität ihrer Arbeit angeht, ihre mediale Verwandlungsarbeit an Stoffen. Unzutreffend allerdings, was ihre persönlichen Beziehungen angeht. Dort sind sie oft ebenso unentwickelt wie andere Menschen auch; leben in denselben Formen der Abspaltung des eigenen Psychischen vom Arbeitsprozeß.
Auch zur oft bedachten aber nie recht gelösten Frage der Differenz von Artist und Psychotiker könnte sich hier eine Antwort ergeben. Artisten organisieren verschiedenste materielle Übertragungsprozesse und treten in sie ein. Diese verwandeln auch sie selber, also „heilen“ körperlich einen Teil ihrer Wunden. Psychotiker, oft okkupiert von ganz ähnlichen Wahrnehmungen wie die Künstler, stellen die Verbindungen zu einem Material des Wirklichen nicht entsprechend her; bleiben ohne Anschlüsse, rotieren im Leeren. Entsprechend empfinden sie sich als Objekt der Vorgänge des Realen, als Ausgesetzte; als Objekt von Strahlen, Strahlungen, Stimmen, die sie verfolgen, verdammt zu allen Formen der körperlichen Aufspaltung und des Paranoischen. Wer nicht entgegenwächst, wächst zurück in sich, droht zu zerfallen in die diversen Unterabteile seiner körperlichen Spaltungen. Ohne „dritten Körper“, ohne die Koproduktion von Schwingungsobjekten wartet: die Wüste.
Coda im Spekulativen. Vilèm Flusser, kein ausgewiesener Theoretiker der Musik, hat mit seinen hoch entwickelten Fühlern für alle Vorgänge zwischen Menschen und Medien einige Punkte dessen, was ich oben zu entwickeln suchte, erstaunlich genau erfasst. Ausgehend vom Gedanken, dass Musikhören eine Wahrnehmungsform sei, bei der sich der Körper der empfangenen Botschaft anpasse oder sogar angleiche, finden sich in seinem kleinen Text Die Geste des Musikhörens die Sätze:„Der menschliche Körper ist für Schallwellen permeabel, und zwar so, dass ihn diese Wellen in Schwingungen versetzen, dass sie ihn ergreifen. Zwar gibt es im Körper spezifische Hörorgane, welche die akustischen Schwingungen in andere, zum Beispiel elektromagnetische Schwingungen übertragen, aber Musik bringt nicht nur den Hörnerv, sondern den ganzen Körper zum Schwingen.“ (150) Schritt eins also: der emotionale Aufruhr. Zwei: „Der Musikhörende konzentriert sich eigentlich gar nicht, sondern er konzentriert die ankommenden Schallwellen ins Innere seines Körpers. Das bedeutet: Beim Musikhören wird der Körper Musik, und die Musik wird Körper.“ (151) Momentane Transformationen also. Drei: „Da der Hörende beim Hören selbst die gehörte Musik ist, da sein ‚Selbst’ die Musik ist, heißt, sich der Musik anpassen eben selbst Musik zu werden.“ (151) Vier: „Kein Erlebnis zeigt so sehr wie das Hören von Musik, dass ‚Geist’, ‚Seele’ oder ‚Intellekt’ Worte sind, die körperliche Prozesse benennen. (…) Daher wäre eine Untersuchung des Musikhörens vom physiologischen und neurologischen Standpunkt wahrscheinlich eine gute Methode, Vorgänge vom Typ ‚logisches Denken’, ‚schöpferische Imagination’ oder ‚intuitives Verstehen’ von ihrer körperlichen Seite aus zu begreifen.“ (152) Was Robert Jourdain, Sebastian Leikert und andere inzwischen ja exakt unternommen haben und dieser Text etwas weiterzuführen sucht. Schließlich, fünf: „Musikhören ist eine Geste, in der sich der Körper auf die ‚mathesis universalis’ einstellt. Er kann dies, weil die akustischen Schwingungen die Körperhaut nicht nur durchdringen, sondern sie dabei zum Mitschwingen bringen. Die Haut, jenes Niemandsland zwischen Mensch und Welt, wird dadurch aus Grenze zu Verbindung. Beim Musikhören fällt die Trennung zwischen Mensch und Welt, der Mensch überwindet seine Haut, oder umgekehrt, die Haut überwindet ihren Menschen. Die mathematische Schwingung der Haut beim Musikhören, die sich dann auf die Eingeweide, aufs ‚Innere’ überträgt, ist ‚Ekstase’, ist das ‚mystische Erlebnis’.“ (153)
Womit nicht nur Jourdains zentrales Wort von der Ekstase beim Umgang mit Music und The Brain gefallen wäre, sondern auch die pythagoreischen mathematischen Berechnungen von den Schwingungsverhältnissen und Saitenlängen in die menschliche Haut selber verlegt wären, die bei Flusser nichts anderes tut, als ihren Menschen zu „überwinden“, ihn aus sich herauswachsen zu lassen und mit der Musik sich zu durchdringen: näher ist in der Tat keine Beschreibung dem gekommen, was hier der „dritte Körper“ heißt. Und auch die Antwort auf die Frage, ob und wie sehr die hier behandelten Vorgänge zur bleibenden Veränderung von Hirnstrukturen führen können, ist in greifbarere Nähe gerückt. Die digitalisierte Raumauffassung, das verschwindende Bewußtsein der Jungen von einer linearen Geschichte könnte, u. a., ersetzt werden durch eine Ausdehnung der Abspeicherung weitgefächerter Musikfelder in einem wachsenden Anteil von Übergangs-Häuten mit vielen Übergangserfahrungen, die an die sich umstrukturierenden Synapsenverschaltungen zurücksenden, was sie einst als akustische Wellen empfangen haben: übers Ohr, übers Hirn, über die Haut, im Herauswachsen aus sich selber. Eine neue Geschichte, nicht einfach ihr Verschwinden. Neue Ausgänge, über „dritte Körper“, aus (nicht) selbstverschuldeten Isolationen.
© Klaus Theweleit, 2011
[1] Vortrag in der Psychiatrischen Klinik Zugersee, 6. 5. 2010; ergänzt durch Einleitung und Schluß aus Vortrag im Vilém Flusser-Archiv, Köln, 2009.
[2] Sebastion Leikert, Die vergessene Kunst. Der Orpheus-Mythos und die Psychoanalyse der Musik, Psychosozialverlag, Gießen 2005. Zitate aus dem Kapitel „Linguistische und genetische Aspekte der Musikerfahrung“, 54-56
[3] nach Leikert, 58. Leikert zitiert auch eine traumwandlerische Formulierung Richard Wagners. Wagner bezeichnete die Melodie als »formgebende Abgrenzung der äußeren Hauthülle«, und weiter, vom Körper her gesprochen: »Harmonie und Rhythmus sind Blut, Fleisch, Nerven und Knochen (…) die Melodie dagegen ist dieser fertige Mensch selbst, wie er sich unserem Auge darstellt«. Nicht etwa metaphorisch, nein: Harmonie und Rhythmus sind.
[4] Bezeichnend die Angewohnheit deutschen Konzertpublikums, beim Mitklatschen immer die Eins und Drei zu betonen, wo jedes Pop-Publikum auf der Welt, angemessen amerikanisiert, auf Zwei und Vier mitklatscht. Backbeat. Afterbeat. „It’s got a back beat, you can’t lose it“. Chuck Berry zur Rock Music. Deutsches Publikum findet diesen Beat gar nicht erst (schärfster Beleg fürs Fortdauern des Fascho-Körpers im deutschen »Wesen«).
[5] George Bernard, Wie Baby die Welt sieht, Video, arte 2005
[6] »Für das Gelingen des Signalaustausches, des wechselseitigen Verstehens und Aufeinander-Eingehens zwischen Mutter und Säugling spielt ein besonderes, erst kürzlich entdecktes Nervenzell-System des Gehirns eine entscheidende Rolle: Das Gehirn besitzt Nervenzell-Netzwerke, die darauf spezialisiert sind, bei anderen Menschen wahrgenommene Signale so abzuspeichern, dass sie selbst nacherlebt und reproduziert werden können. Die Nervenzellen dieses von Giacomo Rizzolatti entdeckten Systems werden als „Spiegel-Nervenzellen“ (mirror neurons) bezeichnet. Dass der Säugling mütterliche Signale „spiegelt“, z. B. versucht, bestimmte Gesichtsausdrücke oder Laute zu imitieren, war aus der beobachtenden Säuglingsforschung schon längere Zeit bekannt. Die Entdeckungen Rizzolattis scheinen die erstaunliche, kurz nach der Geburt einsetzende Fähigkeit des Säuglings, empfangene Signale aufzunehmen und durch Imitation zurückzuspiegeln, nun aber auch neurobiologisch erklären zu können. (…) Nach den Erkenntnissen der modernen Säuglingsforschung ist dies wechselseitige, spiegelnde Hin- und Zurückspielen von einfachsten Signalen (Blicken, Gesichtsausdrücken, Lauten, Berührungen) das entscheidende „Geheimnis“ der frühen Mutter-Kind-Kommunikation«. J. Bauer, 84
[7] »Das erste, was Säuglinge an kommunikativem Verhalten zeigen, ist der Versuch, mütterliche Gesichtsausdrücke und den Klang ihrer Stimme zu „spiegeln“«. Joachim Bauer, Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern, Fft/M, 2002, S. 12
[8] Suzanne Maiello, (1999) „Das Klangobjekt. Über den pränatalen Ursprung auditiver Gedächtnisspuren“, in Psyche, 53, 137-157, Leikert, a.a.O., 55
[9] Original: Music, the Brain, and Ecstasy. How Music Captures Our Imagination, NY 1997
[10] Jourdain, 393. »Da alles, was wir geistig tun, seelisch fühlen und in Beziehungen gestalten, seinen Niederschlag in körperlichen Strukturen findet«, macht eine Psychologie für »Seelen ohne Körper« keinen Sinn, schreibt J. Bauer, Das Gedächtnis des Körpers, Fft 2002, 8
[11] dieses und die folgenden Zitate aus D. W. Winnicott, Von der Kinderheilkunde zur Psychoanalyse, Fft 1983, (London 1958), Kapitel „Zustände von Entrückung und Regression“, 208-220
[12] »Nach übereinstimmenden Erhebungen verschiedener Hirnforscher ist die rechte Gehirnhälfte bei der Identifikation von Tönen überlegen. Weil das linke Ohr Musik besser aufnimmt und die Nervenfasern vom linken Ohr überwiegend zur rechten Gehirnhälfte gehen. Bei Profi-Musikern ist es seltsamerweise umgekehrt. Mit zunehmendem musikalischem Training „wandert“ die cerebrale Dominanz für Melodien von der rechten in die linke Hemisphäre. Dies deutet darauf hin, daß Profimusiker beim Hören von Musik eine Reihe erlernter Fähigkeiten anwenden, die den meisten Menschen fehlen«. Jourdain, a.a.O, 117
[13] Gerhard Roth, Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Fft 2001, Zitate aus dem Kapitel „Neurobiologie und Psychoanalyse. Oder; Hatte Freud Recht?“, 430-441
[14] »Ein Teilorgan des limbischen Systems ist der Mandelkern (Amygdala), der Erinnerungsspuren darüber abspeichert, ob Ereignisse der Situationen für den eigenen Organismus angenehm oder schädlich beziehungsweise unangenehm (aversiv) waren. Mit seinem „Wissen“ und seiner Fähigkeit, bei Bedarf tiefer gelegene Hirnzentren zu alarmieren, beteiligt sich der Mandelkern entscheidend an der Bewertung neuer Situationen und Ereignisse. Ebenfalls zum limbischen System gehört ein Hirnteil, der sich erst in den letzten Jahren als der vielleicht wichtigste Hirnteil unsere Menschseins herausgestellt hat: der Gyrus cinguli. Der Gyrus cinguli (deutsch: „Gürtelwindung“) läuft paarweise, rechts und links tief in der von vorn nach hinten laufenden Teilungsfurche des Gehirns. Er erwies sich aufgrund neuerer Untersuchungen als Sitz des Selbstgefühls, des Mitgefühls mit anderen Menschen und als Ort der Lebens-Grundstimmung«.Joachim Bauer, Das Gedächtnis des Körpers, a.a.O., 72
[15] Dies und alle folgenden Zitate aus Sebastian Leikert, Die vergessene Kunst. Der Orpheusmythos und die Psychoanalyse der Musik, 146f
[16] fast alle Popsongs erzählen von Traumatisierungen, bzw. von ihren Transformationen in Aushaltbares, seien es Perversionen, seien es Phantasien reiner Lust.
[17] Es gibt intensive Ausführungen zur Bedeutung des Schweigens in der lacanischen Analyse in Leikerts Buch
[18] Zu der nicht zuletzt die gesellschaftsbildende Kraft der Musik durch gewöhnliches Singen gehört. In diesem omnipräsenten Singen das Wunder des Oktavsprungs. Er wird automatisch gemacht, überall auf der Welt, unabhängig von den jeweils kulturell geltenden Tonleitern. Kinder finden »denselben« Ton eine bis zwei Oktaven höher; Bässe den ihren in der Oktave tiefer. Und alle finden, es ist »derselbe« Ton. Das ist nicht eine Produktion des Gehirns, wie das Hören in Intervallen eine ist. Das ist eine klangliche Übereinstimmung der Schwingungsfrequenzen bei Verdoppelung oder Halbierung der Schwingungsfrequenz, die physikalisch da ist; sagen wir ruhig »naturgesetzlich«. Einstimmung, Beitritt zu einem umfassenderen Klangkörper.
[19] »Es ist unleugbar, dass die Bezwingung der Übertragungsphänomene dem Psychoanalytiker die größten Schwierigkeiten bereitet, aber man darf nicht vergessen, dass gerade sie uns den unschätzbaren Dienst erweisen, die verborgenen und vergessenen Liebesregungen der Kranken aktuell und manifest zu machen«. Freud, GW VIII, 374. Den Rahmen dieser und einer Reihe weiterer früher Definitionen Freuds, die die Übertragungsvorgänge in der Wiederbelebung der libidinösen Besetzung der Elternkörper durch das Kleinkind verorten; in denen also der Patient »den Arzt unbewußt die Rolle der geliebten oder auch gefürchteten Elternfiguren spielen lässt«, hat die analytische Praxis heute erheblich erweitert. Man würde auch nicht mehr von »Bezwingung« der Übertragungsphänomene sprechen, sondern von ihrer Nutzung für das analytische Arbeitsbündnis.
***
Éloge d’amour & Notre Musique.
Reality-Fiction, Krieg & Frieden, in den späten Filmen von Jean-Luc Godard
Auf der Leinwand tanzende Farbflecke. Lichtreflexe auf einer regennassen Windschutzscheibe; gemalt von den Scheinwerfern auf der Gegenfahrbahn. Ein nie gesehenes Farbenspiel. Wir sind kurz vor Ende des Films Éloge d’amour. Wir sehen solche Farben nicht, wenn wir im Auto sitzen und fahren. Würden wir hinschauen und sie aufnehmen, hieße das Crash und Unfall. Wir konzentrieren uns auf den Verkehr. Die Kamera nicht, sie kann hinsehen. Und zeigt Ungeahntes. Auf der Tonspur dazu eine Streichermusik; und ein Dialog, einer der wichtigsten des Films. Mit den Bildern hat er nichts zu tun; jedenfalls nicht direkt. Eine Frauen- und eine Männerstimme aus dem Off:
Sie: Sie sind nicht sehr gesprächig.
ER: Es ist ziemlich schwierig für mich zur Zeit – meine Freundin und ich haben uns getrennt. Wir waren zehn Jahre zusammen. Es ist übrigens merkwürdig, wie die Dinge sinn bekommen, wenn sie zu Ende gehen.
Sie: Weil in dem Moment die Geschichte beginnt, ganz auf sich gestellt.
Er: Die Fee berührte den Frosch mit dem Zauberstab und plötzlich war die Prinzessin da.
Sie: Das Imperfekt erzeugt ein Bild der Gegenwart.
ER: Jede Frage entweiht ein Geheimnis.
Sie: Ihrerseits wird die Frage durch die Lösung entweiht. Es ist kein Zufall.
Er: Was meinen Sie?
Sie: Es gibt den Dienstboteneingang und es gibt den Haupteingang. Diese da betreten durch den großen Eingang die Wohnung der Welt; und lassen uns den Dienstboteneingang: sie, die Wörter.
Er: Anhand unseres Sprachgebrauchs kommen wir zu dem Schluß, dass die Wörter uns Ideen repräsentieren.
Sie: Der Mensch fabriziert Ideen. Er ist ein kühner Ideenfabrikant.
Er: Die Situation, in der wir uns heute befinden, entspringt eben diesen Fähigkeiten, Mademoiselle.
Sie: Noch ein Wort. Kennen Sie den Aufsatz von Augustinus? Das Maß der Liebe ist, maßlos lieben.
ER: Ja.[1]
Wir sehen nur einmal kurz das Gesicht der Frau bei diesem Dialog. Was haben wir sonst gesehen in den tanzenden bunten Scheinwerferlichtern; im Rot des Bilds beim Durchfahren eines Tunnels? Nichts, was wir direkt angeben könnten. Wenn wir uns nur aufs Bild konzentrieren, könnten wir sagen, die Kamera malt. Sie beweist, dass sie mit einfacher Aufnahme von Lichtreflexen Bilder malen kann wie der versierteste abstrakte tachistische Maler. Im Dialog darunter allerdings die »Aussage«, dass die Wörter eine Hauptrolle auf der Bühne der Geschichte beanspruchen; den Menschen (wie auch den Bildern) aber nur den Dienstboteneingang lassen.
Die Godard-Filme Éloge d’amour von 2001und Notre Musique von 2004 sind, wie alle Arbeiten des späten Godard, Filme zum Verhältnis von Wort und Bild und zum Verhältnis der Wörter und Bilder zu Handlungen; zu handelnden Personen, die sich bei Godard nicht mehr zu Charakteren ausbilden bzw. zu Subjekten. Sähe man bei ihrem »Gespräch« die Gesichter der Sprechenden, ihren Ausdruck, die individuellen Lippenbewegungen: wir bekämen das Gefühl von einem unnatürlichen, einem gedrechselten Dialog. Die Wörter würden ihren Charakter ändern. Der Mann, der anfängt mit »meine Freundin und ich haben uns getrennt«, würde tatsächlich von einer Freundin sprechen, einem menschlichen Wesen. So wie das Gespräch sich entwickelt, ist aber nicht gesagt, dass er von einem Menschen spricht (zumal man diese Freundin aus dem Film davor nicht kennt. Die Rede entfaltet sich vielmehr als eine Reflexion über Wörter (=Farbreflexe auf der Scheibe). Vielleicht sind die Wörter »die Freundin«, von der er sich getrennt hat.
Seine Gesprächspartnerin antwortet auch auf dieser Ebene. So dass der zitierte Satz von Augustinus am Ende sich weniger auf die Liebe zwischen Menschen bezöge, als auf »die Liebe zum Bild«. Diese wäre, in den Augen Godards, eine maßlose; maßlos und breit gefächert. Er macht Bilder von überbordender »Schönheit«, aber ebenso von Kargheit, Schlichtheit, Dunkelheiten und montiert Wörter und Reden dazu, Literatursätze oder auch improvisierte, bedeutungsschwere, belanglose, tiefernste und solche von leichtestem Witz.
Durch beide Filme ziehen sich als Hintergrundfolie Kriege: der Krieg in Bosnien Mitte der 1990er Jahre und der 2. Weltkrieg. Erstmals in seinen Histoire(s) du cinéma (1995/9) macht Godard diesen Krieg zu seinem zentralen Gegenstand. Ich zitiere aus seinem Text, gesprochen von ihm selber aus dem Off der Histoire(s):
»es wird notwendig, die Aufmerksamkeit der europäischen Regierungen auf einen Tatbestand zu lenken, der so geringfügig ist, dass die Regierungen ihn überhaupt nicht zu bemerken scheinen…man ermordet ein Volk. (…)
wir werden die europäischen Regierungen in Erstaunen versetzen indem wir sie darüber belehren (…) dass zu dieser Stunde in allernächster Nähe hier, unter unseren Augen massakriert gebrandschatzt geplündert vernichtet wird, Väter und Müttern erwürgt, Mädchen und Jungen verkauft werden. Dass die Kinder, die zu klein sind, um verkauft zu werden, mit einem Säbelhieb niedergemäht, die Familien in ihren Häusern verbrannt werden. (…)
wir belehren die Regierungen Europas darüber, dass man die schwangeren Frauen aufschlitzt, um die Kinder in ihren Bäuchen zu töten, dass es auf öffentlichen Plätzen haufenweise Skelette von Frauen mit Spuren der Aufschlitzung gibt, dass die Hunde in den Straßen das Hirn vergewaltigter Mädchen fressen, dass all dies schrecklich ist, dass eine Geste der europäischen Regierungen genügte, um dies zu unterbinden, und dass die Wilden, die diese Widerlichkeiten begehen schreckenserregend sind und dass die Zivilisierten, die diese Untaten zulassen fürchterlich sind. (…)
die Regierungen sagen, dass sei übertrieben; jja, das ist übertrieben. Nicht in wenigen Stunden wurde die Stadt Balak ausgelöscht, sondern in wenigen Tagen. Man spreche von 200 niedergebrannten Dörfern, es gebe aber nur 99. Was ihr die Pest nennt ist nur Typhus. Nicht alle Frauen seien vergewaltigt worden, nicht alle Mädchen seien verkauft worden, einige sind entkommen…«
»Die Beschwichtigungen machen es nur schlimmer…«[2]
Man sehe mit den Augen dieses Texts die ersten 10 Minuten von Notre Musique an. Die Montage dieser Eruption von Gewalt – wie so viele Werke der europäischen Kunst, die von der Hölle zu handeln vorhaben, bedient sich auch Godard Dantes Divina Comedia – heißt in Godards Film L’Enfers, Inferno. Godards Rundgang durch die Höllenkreise macht dabei keine prinzipielle Differenz zwischen Fiktion(en) und Realität(en). Bilder aus dem jugoslawischen Zerfallskrieg der 1990er Jahre stehen neben Bildern aus WK II, KZ-Bildern, Folterbildern, BdM-Mädchen auf Fahrrädern und Kampfbildern aus Kinofilmen, von Eisenstein bis John Ford, collagiert mit Gemälden verschiedener Maler sowie Bildern aus heutigen Kriegen, Afrika, Sarajewo – Bilder, psychedelisch eruptiv montiert, die selbstverständlich demonstrieren, dass es einen Unterschied zwischen sog. Fiktion von Krieg und realer Wirklichkeit von Kriegen auf einer Bildebene nicht gibt. Unterstrichen von den Farbbearbeitungen, denen Godard die Bilder unterzogen hat. Mal sind sie grell überfarbig, computerbehandelt, verwaschen schwarz-weiß, zu hell oder zu dunkel entwickelt, gerastert oder verpixelt; von ihren fotografischen Ursprungszuständen jeweils weit entfernt.
Nur ganz wenig Text: ein knapper Satz aus dem Off sagt, dass Kräfte auf die Erde kamen, gewillt, alles auszulöschen. Dann erscheint im Wirbel der Kriegsbilder ein kurzes Bild einer hübschen TV-Reporterin mit Mikrofon, die ein Kriegsereignis kommentiert. Das Bild ist so kurz, dass man nicht mitbekommt, zu welchem Ereignis sie spricht. Es ist kaum eine Sekunde lang. Aber es reicht, um das Unangemessene ihres Auftritts, ihres Daseins, ihres Outfits, ihrer gestylten Frisur, die Unverschämtheit ihrer Klamotten, ihrer legeren Haltung gegenüber »dem Geschehen« als prinzipielle Unangemessenheit der Arbeit der TV-Leute, der professionellen Nachrichtenkaste nicht nur aufzuzeigen, sondern ins Auge zu brennen. Wie mit einem Laser bekommt man es auf die Hirnrinde: Ihr seid professionelle Wirklichkeitsvernichter. Godard braucht dazu keinen Ton zu sagen. Alles was wir hören ist eine Klaviermusik, kühle, isolierte Akkorde. Was spricht, ist die Montage der Bilder.
Sie zeigt, dass die Bilder des Krieges und die Kriegsbilder der Spielfilme sich gegenseitig weder etwas nehmen noch hinzufügen; sie sind in ihrem Schrecken ebenbürtig. Sie sind Schrecken. Während das Bild der Nachrichtenfrau aus einer totalen Unwirklichkeit kommt – der unseres täglichen Fernseh-Abendmahls.
An einigen Stellen setzt eine Frauenstimme einen kontrapunktischen Akzent. Sie zitiert den Satz aus dem Zentralgebet der Christenheit: und vergib uns unsere Schuld…wie wir vergeben…aber hier wird nichts vergeben, hier wird gemetzelt, geschossen, geköpft. Inferno. Nicht dasjenige Dantes, sondern jenes, das wir in den Köpfen haben müssen/müssten, wenn wir die laufende Geschichte, die laufenden Katastrophen tatsächlich wahrnehmen würden, sie kennen würden und sie erinnern.
Gegen Ende von Inferno das Bild eines einzelnen Soldaten mit Gewehr, ein stumpfes Lachen in seinen Zügen – Bild des obligaten Grinsens auf den Mienen der Schlächter. Und eine Schrift im Bild, in Englisch: »Do you remember Sarajewo«.[3] Der bosnische Krieg Mitte der 1990er Jahre, Europas Urverbrechen der Jetztzeit, lässt Godard nicht los. So wie in jedem seiner Filme ab Mitte der 60er Jahre der Vietnam-Krieg aufgetaucht war, so seit Mitte der 90er der Krieg in Bosnien. Inferno sagt: Teil von Notre Musique ist die kriegerische Auslöschungsgewalt unserer Kultur(en).
Im nächsten Schnitt verlegt der Film seinen Schauplatz ins heutige Sarajewo. Godard lässt dort ein fiktiv-reales Symposium stattfinden. Schnitt und Sprung zum Flughafen. Die Symposiumsredner treffen ein, der palästinensische Autor Mahmoud Darwish, der spanische Autor Juan Goytisolo. Godard selber ist geladen, ein Panel abzuhalten über das Verhältnis von Text und Bild. Dialog Studentin/Symposionsgast: »Wenn ich ihnen zuhöre, frage ich mich, warum werden Revolutionen nicht von den humansten Menschen gestartet«? An seiner Stelle antwortet Godard: »Weil humane Menschen keine Revolutionen starten. Sie gründen Bibliotheken«. Der Gast ergänzt, während er das Fenster des gelben Mercedes-Taxis hochkurbelt: »Und Friedhöfe«.
Damit ist die Gegenwelt zu den Killern aus der Inferno-Sequenz gesetzt. Die erste Lecture des »Symposiums in Sarajewo« zur Gewalt bekommen wir schon im Auto; aus dem Off dieses: »Ein Mann, der jemanden tötet, um einer Idee zu nützen, nützt nicht einer Idee, er tötet einen Mann«. Notre Musique ist ein Film über Poesie und Gewalt, Wörter, Bilder und Krieg. »Wenn alles vorüber ist, ist nichts mehr wie vorher. Die Gewalt hinterlässt ihre tiefe Narbe. Die Grausamkeit der Vernichtung ist unumkehrbar. Das Vertrauen in die Welt, das der Terror zerstört, ist unwiederbringlich. Zu sehen, wie der Mitmensch sich gegen dich wendet, erzeugt ein Gefühl tiefsten Horrors. Die Gewalt beschädigt die Lebenslinie. Ein Überlebender ist nicht nur verändert, er ist ein anderer. Das Überleben wird zum Albtraum derer, die übrig geblieben sind. Jeder von uns kann zu einer Gefahr für den anderen werden. Der Körper kann eine Waffe sein. Wenn wir wissen, wo wir selbst verletzbar sind, kann jeder von uns jedem anderen Leid zufügen«. Rimbauds zu Tode zitierter Satz aus der Frühmoderne: Ich ist ein anderer, wird konkret: Wir sind andere, da wir durch diese Gewalt gegangen sind. Den Sprecher dieser Sätze, es »ist« wohl Goytisolo, müssen wir mehr erraten, als das wir ihn sehen. Menschen bilden sich nur manchmal zu Gesichtern aus vor dieser Kamera; wir hören ihre im Dunkeln irrenden Stimmen.
Andererseits fehlt es nicht an Filmscherzen. Während man sich auf die Taxis verteilt, ruft einer: »So, Miss Lerner – Have you ever been stung by a dead bee?« Antwort nicht nötig; sie ergeht in unseren Köpfen. In Howard Hawks Film To Have and Have Not (seinem schönsten) – nach Roman von Hemingway – entscheidet die Antwort auf diese Frage darüber, wer ein Idiot bzw. Verbrecher ist und wer nicht. Vernünftige Menschen, wie Lauren Bacall, wissen, dass tote Bienen stechen, und zwar am schlimmsten. Heißt: die Vergangenheit ist niemals tot. Nur Idioten (oder Gangster) können das behaupten.
Beim Besuch der Gäste in der Zentralbibibliothek antwortet der Bibliothekar auf die Frage, ob Schriftsteller wüssten, wovon sie schreiben: »Nein, Schreiber wissen nicht, wovon sie schreiben. Homer war blind und zurückgezogen. Er kennt den Krieg nicht, hatte keine Ahnung von Schlachtfeldern«. Egal ob das für Homer stimmt (seine »Blindheit« ist eine mythologische Konstruktion), für den Schriftsteller, der gleich darauf in der Universität spricht, stimmt das nicht. Godard zeigt uns den palästinensischen Dichter Mahmoud Darwish im Gespräch mit einer israelischen Studentin. Ein »wirklicher Schriftsteller« mit der fiktiven israelischen Studentin »Olga«, die im Film für eine israelische Zeitung berichtet; ein Autor also, der sich selbst darstellt, zusammen mit einer Schauspielerin.[4]
Der Palästinenser Darwish spricht aus einer Position, die es nicht gibt: der des »unbekannten Sängers von Troia«: Wir haben Homer, wir haben die Stimme der Sieger, die der unterlegenen Troianer haben wir nicht. »Ich frage mich, hat ein Land mit großen Poeten das Recht, ein Land, das keine hat, zu beherrschen? Und ist das Grund genug, seine Niederlage zu rechtfertigen? Ist Poesie ein Zeichensystem oder ein Instrument der Macht?«. Er möchte aus der Position der Verschwundenen sprechen. »Sie sprechen wie ein Jude«, sagt die Israelin. »Das hoffe ich«, sagt er. »Denn das wird heute als etwas Positives gesehen…Wissen Sie, warum die Palästinenser heute berühmt sind? Weil sie euch zu Feinden haben. Das Interesse an uns stammt vom Interesse an der jüdischen Sache. Wir haben das Unglück und das Glück eurer Feindschaft. Ihr habt uns die Niederlage gebracht und den Ruhm«. »Wir sind euer Propagandaministerium«, sagt die israelische Studentin. »In der Tat«, sagt Darwish.
So legt der Film das Verhältnis Griechen/Trojaner über das Verhältnis Israelis/ Palästinenser, mit dem Schluß: »Ein Volk ohne Poesie ist ein geschlagenes Volk. Troja ging unter«. Dem schmerzhaften Paradox, dass es ohne Israel kein Interesse an Palästina gäbe, stimmt der palästinensische Poet zu. Mit der (poetischen) Zuspitzung, dass Israel Palästinas Propagandaministerium sei, setzt die israelische Journalistin dann Israel in eine Position, die jene von Goebbels aufruft; eine seltsame »Logik«, die kurz aufblitzt, um gleich wieder zu verschwinden. Ausgewalzt werden solche Gedanken nicht. Ohnehin liebt »die israelische Studentin« es, in Rätseln zu reden. Die Sprache, die Wörter, scheinen nie das oder nur das zu sagen, was sie einfach sagen. Sie bringt es schießlich in den Satz: »Wenn irgendwer mich verstanden hat, dann war ich nicht klar«. Dass »Klarheit« in Wörtern, Klarheit im Sinne von »Verständlichkeit« immer auch an Dummheit grenzt, war schon für Karl Kraus ein klar erkanntes Problem. Sein Satz in Richtung der Zensurbehörde der Habsburger Monarchie: »Eine Satire, die der Zensor versteht, wird zu Recht verboten«, begleitet mich seit frühesten Studententagen. Eine Warntafel, die besagt: Verständlichkeit ist auch nur eine Art Zensur. Sie zensiert die Komplexität der Dinge weg, radikal.
Godard erhöht die Komplexität, indem er über die Komplexe »Troja«, »Palästinenser/Israelis« und »Ermordung der bosnischen Bevölkerung« in einem weiteren Schritt die Ausrottung der Indianer in Amerika legt. Unvermittelt tauchen in der Bibliothek in Sarajewo, untergebracht in einer halbzerbombten Therme, kostümierte Indianer auf und deklamieren den Text einer historischen Deklaration zu ihrer Lage. Die Klage über ihre Auslöschung wird zur Klage der bosnischen Bevölkerung über ihre Auslöschung und schließt die Klage der palästinensischen ein.
Wie kann solche Schichtung im Film Bild werden? In Godards Kopf/Archiv fand sich das Bild der berühmten Steinbogenbrücke über die Neretva in Mostar, die es nicht mehr gibt: das Symbol aller Zerstörung in diesem Krieg. Er schickt »Olga« auf Foto-Tour nach Mostar. Sie fotografiert die neuerrichtete Brücke, eine Stahlkonstruktion (in Betrieb genommen unter EU-Kommissar Hans Koschnick)[5], und mit einem Mal stehen da Indianer im Bild. Indem Godard einige seiner Schauspieler in Indianer-Outfit steckt, und zwar in solches der deutschen Winnetou-Filme, die dort gedreht wurden, und sie in Mostar vor der berühmten zerstörten/neuerbauten Brücke für ein Foto posieren lässt, dreht er die Schraube seiner Gleichbehandlung sog. Realitäten und sog. Fiktionen eine Drehung weiter: die verschwundenen amerikanischen Indianer leben als Legenden in Büchern und in Hollywoodwestern; so waren sie zu sehen am Anfang, im Inferno-Teil von Notre Musique. Nun stehen sie als körperlich-aktuelle Bildrealität vor der neu erbauten Brücke und zeugen von ihrem Nicht-Verschwunden-Sein; zeugen von ihrem Fortdauern in den heutigen Genoziden, in den bosnischen Massakern, in den Überlebenden von Sarajewo.[6]
Fast genau in der Filmmitte dann Godards eigener Auftritt als »Symposiums-Redner«. Die Legende JLG tritt vor die Kamera und erläutert Bilder. Man darf gespannt sein – d. h., zunächst tritt die Kamera hinter ihn und zeigt seinen Hinterkopf. Er sitzt, vor ihm in drei Stuhlreihen die Studenten, vielleicht dreißig, einige verteilt an den Wänden, stehend, halbdunkler Raum. Godard zeigt sein erstes Bild, ein Foto, die Ruinen-Skyline einer Stadt, die gebrannt hat, bombardiert wurde. »Wo ist das«? Antworten: »Stalingrad…Warschau…Beirut…Sarajewo…« »Nein: Richmond, Virginia, 1865…the American Civil War« ‑ der erste Krieg mit entfalteter moderner Waffentechnologie. Demonstriert werden: die Fallen des »historischen Blicks«. Was »bombardiert« aussieht, muß nicht 20. Jhd. sein.
Nun: das Kino. Aus zwei Fotos von einem Mann und einer Frau, die im gleichen Kameraabstand und Kamerawinkel aufgenommen sind, leitet Godard den Satz ab, dieser Regisseur – Howard Hawks – kenne den Unterschied nicht zwischen Mann und Frau. Die Fotos – sie zeigen Cary Grant und Rosalind Russell – stammen aus Howard Hawks’ Film His Girl Friday; den Filmtitel nennt Godard nicht. Wer den Film kennt, weiß, dass man ihm den Vorwurf der Männer-/Frauen-Nivellierung gewiß nicht machen kann. Man muß bei Godard immer damit rechnen, dass er, wenn er ansetzt, uns etwas zu erklären, uns gleichzeitig veräppelt. Heißt: er präsentiert sich als Zauberkünstler, als magician.[7]
So auch, als er den Studenten/uns ein Foto des Schlosses Helsingör zeigt; mit der Erläuterung, der deutsche Physiker Heisenberg habe das Bauwerk als »nichts Besonderes« empfunden beim Vorbeispazieren mit seinem dänischen Kollegen Borg. »Das ändert sich, wenn man hört, dass dies »Hamlets Schloß« ist«, habe Borg geantwortet. Wir sehen dies Schloß die ganze Leinwand ausfüllen, in Farbe. Ehe wir entscheiden können, ob Borgs Aussage unseren Blick auf dies Schloß verändert, erscheint ein anderes Schloß auf der Leinwand; nicht in Farbe, dunkel, umwölkt. Das Bild könnte aus Murnaus Film Schloß Vogelöd sein. Dieses sieht unheimlich aus. Das Helsingör-Foto nicht. Godard, dozierend: »Helsingör, das Reale. Hamlet, das Imaginäre«. Und nun die Umkehrung: »Das Imaginäre: Gewissheit. Das Reale: Ungewissheit«.
Gut, wir lassen uns gern ein wenig an der Nase herumführen, wenn’s Godard ist, der die Nase hält. Vielleicht führt es wohin. »Das Bild ist Freude. Aber daneben liegt das Nichts. Alle Kraft eines Bildes kann nur durch es selbst ausgedrückt werden«. Etwas kryptisch. Es folgt weiterer Zauber, eine Bildserie zum Komplex Schuß/Gegenschuß. Godard zeigt jeweils zwei verschiedene Bilder zu einem als »gleich« gesetzten Vorgang; z. B.: Auszug der Juden aus Ägypten – Auszug albanischer Familien aus dem Kosovo. Schuß/Gegenschuß. »1948: die Israelis gehen durchs Wasser, um das Heilige Land zu erreichen. 1948: die Palästinenser gehen durchs Wasser, um zu ertrinken. Schuß/Gegenschuß«. Führt zu: »Die Juden wurden Stoff für Fiktion, die Palästinenser Stoff für Dokumentation«. Das ist gerade nicht Demonstration von Schuß/Gegenschuß als Grundstein traditioneller erzählerischer Filmgrammatik, sondern Anleitung zur Montage von Gegensätzen.
So bleibt auch der Titel des Films mehrdeutig; er weist auf die Gewalt unserer Kultur, wie auf ihre »Musiken«, auf Spielweisen, auf Lebensweisen, auf Montageweisen, auf unsere Art, mit den Wirklichkeiten umzugehen.[8] Ins Bild bringt Godard dafür (erneut) eine pendelnde Glühbirne, dazu das Wort Lumières, Licht. »Das Prinzip Kino (hören wir ihn sagen) ist es, zum Licht hinzugehen und es auf unsere Nacht scheinen zu lassen. Notre Musique«. Die hin- und herpendelnde Glühbirne, die wir dabei sehen, kennen wir spätestens aus Godards Alphaville, 1965. Sie beleuchtet (und verdunkelt) dort abwechselnd die Gesichter von Eddie Constantine und Akim Tamiroff in einem dunklen Treppenhaus und leitet einen Mord ein. Godard hat ihr abwechselndes (mordankündigendes) Hell/Dunkel aus Orson Welles’ Touch of Evil in sein Alphaville hineintransplantiert (vgl. Theweleit, Deutschlandfilme, Fft. 2004). Welles wiederum dürfte sie aus F. W. Murnaus Faust-Film importiert haben; dort pendelt sie ebenso erkenntnistheoretisch-mephistophelisch. Das Licht macht hell; aber sein Dunkel bleibt böse. Notre Musique.
»Das Feld des Textes hat das Visuelle überlagert«, zitiert Godard nun Céline; der das schon 1936 gesehen habe. Der Text und das Visuelle: Orpheus und Eurydike. Orpheus, das sei die Literatur, die sich »auf der Treppe« umdrehe und Eurydike, das Kino, zurück in die Unterwelt schicke. So Godard in einem Interview zum Tod von Alfred Hitchcock. Die Literatur, das Wort, habe das Kino besatzt und beute es aus. Das war um 1980. Und funktioniert so nicht mehr für den Godard von 2004. Von seiner Bild-Lecture vor Studenten in Sarajewo gilt vielmehr: Das Wort entzieht dem Bild den Boden; oder aber es zieht ihm erst einen ein. Ebenso wird aber das Wort vom Bild dementiert; beide werden »bodenlos« und mehrdeutig und im Zweifelsfalle nichtssagend. Godards Gewissheit von der artistischen Überlegenheit der Bilder scheint zusammengebrochen. In seinem ersten Film im neuen Jahrtausend, Éloge d’amour hat Godard das auch schon formuliert: die Bilder zeigen nichts mehr.
Godards Magier-Auftritt auf dem »fiktiven« Symposium in Sarajewo endet mit der Frage der Studentin, die seinen Auftritt dort filmt, ob die kleine, handliche Digicam, mit der sie das tut, vielleicht »das Kino retten« werde. Wir sehen, wie Godards Gesicht in einer langen Einstellung, gefilmt im Halbdunkel, mit einem langen schwarzen Schweigen darauf antwortet. Die Digicam enthüllt an seinem Gesicht, dass er die Antwort nicht einfach verweigert; sie zeigt vielmehr, dass er sie nicht weiß. (Wie etwa David Lynch sie zu wissen glaubt).
Zum Schluß von Notre Musique setzt Godard die Maske der Divina Comedia, die wir im Lauf des Films fast vergessen haben, noch einmal auf. Nach dem ersten Teil – Inferno – war der zweite überschrieben mit Purgatorio; nun folgt der dritte, der nicht anders heißen kann als Paradiso.
Am Ende dieses Teils sagt eine Stimme aus dem Off zwei Sätze, die die Untertitel so wiedergeben: »It was a cool day and very clear. You could see a long way – but not as far as Olga had gone«. – Olga, die israelische Studentin vom Symposium in Sarajewo. Was hat Olga in diesem Satz zu suchen? Den Satz kenn’ ich doch. Velma steht da im Original. Es sind die Schlußsätze von Raymond Chandlers Farewell, My Lovely; »his greatest book« nach Meinung der Chandler-Lovers. »Meine Velma«, nach der der starrköpfige Moose Malloy, nur knapp zwei Meter hoch und nicht breiter als ein Bierwagen, das ganze Buch durch gesucht hatte; bis zum bitteren Ende (für beide); Velma, im Film von Dick Richards (1975) gespielt von Charlotte Rampling. Neben ihr Robert Mitchum als Philip Marlowe; ein später Nachläufer des film noir, in Farbe. Es ist aber nicht Philip Marlowes Stimme, die das hier sagt, es ist die Stimme Jean-Luc Godards. Und kein Krimi der Schwarzen Serie, der da läuft, sondern Notre Musique aus dem Jahr 2004. Godard lässt ihn tatsächlich enden mit den Schlusssätzen aus Chandlers Thriller.
»Velma« bei Chandler ist eine attraktive hochkarätige Kriminelle, die aber einige Bewunderung seitens Phillip Marlowe genießt. Wie gerät »Olga« in Godards Verschiebung an ihre Stelle? Es geht so: Godard, zurück in seiner Wohnung am Genfer See, erfährt am Telefon beim Blumenwässern von Olgas Tod. Der junge arabische Dolmetscher vom Symposion berichtet ihm: Olga hatte gedroht, in Jerusalem ein Kino in die Luft zu sprengen. Die Untertitel sagen: »She said if there was one Israeli, who’d die with her for peace, not for war, she’d be happy«. Und hatte dann das Kino sich leeren lassen. Aber niemand war geblieben, kein einziger. Dann kamen die Wachleute und erschossen sie. In ihrer großen roten Tasche waren aber nur Bücher, keine Bombe (erfährt Godard am Telefon).
Notre Musique legt über den bosnischen Krieg Mitte der 90er Jahre, nicht nur den »trojanischen Krieg«, nicht nur die Auslöschung der nordamerikanischen Indianer, nicht nur den Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, er legt über das zerstörte, aber weiterlebende Sarajewo das zerstörerische (aber weiterlebende) Los Angeles von Raymond Chandler, mit der Frage »was für eine Art Kriminelle« eine israelische Studentin ist, die in einem fingierten Selbstmordattentat jemanden sucht, der bereit ist, mit ihr zu sterben: für den Frieden. »Unsere Musik«: das ist die Gewalt (und die Poesie jener Völker, die sich das Recht nehmen, andere Völker, Völker ohne Poesie, zu töten). Das möchte die Pazifistin Olga mit ihrem (tödlichen) Selbstversuch beenden. Und um das zu erzählen – wir sehen all das nicht im Bild, sondern Godard, der seine Blumenkästen wässert – um all das zu erzählen, bedient sich Godard der Maske von Chandlers Roman, der Maske des film noir, in der an dieser Stelle, die Handlung der jungen Israelin beleuchtend, Godards Film sagen kann: »Es war ein kühler, klarer Tag. Man konnte sehr weit sehen. Aber nicht so weit wie Olga gegangen war«.
Im Schlussteil, dem Paradiso, haben wir vorher aber gesehen, dass diese Olga, in Termini des Films, gar nicht »tot« ist. Wir sehen sie im Grünen an einem Fluß entlang wandeln; verträumt, sinnend. Und realisieren: ah, das ist Olga im Jenseits; im Paradiso. Es ist aber nicht Dantes Paradiso. Das Paradies, in dem sie wandelt, ist von einem Zaun umgeben. Und dieser ist bewacht von bewaffneten US-Marines. Diese sitzen da und angeln, die MP’s neben sich am Boden; und kontrollieren, wer hinein darf in dies Paradiso. – Checkpoints! Ganz selbstverständlich tauchen in unserem Kopf die israelischen Checkpoints auf, an denen entschieden wird, von bewaffneten Wächtern, welcher Palästinenser hinein darf nach Israel; und welche nicht. Dann erscheint eine Gruppe junger lachender Menschen im Bild, die sich einen Ball zuwerfen. Wie die jungen israelischen Soldaten am Strand von Tel Aviv, die ich dort spielen sah in der Mittagspause; die Gewehre weggestellt, in Zivilklamotten. In der Maske von Dantes Paradiso zeigt Godard uns junge Israelis, die den Krieg vergessen haben; die Ball spielen (am Ufer des Acheron), in einer Utopie des Paradiso, beschützt von US-Marines, die friedlich angeln und den Eingang bewachen.
Man sieht, dass es heute Jean-Luc Godard ist, der keine Probleme hat, den von Luis Bunuel an verschwundenen Drehorten zurückgelassenen Spielball der Surrealisten aufzunehmen und weiterzuspielen; den sur-realistischen Gestus einzufügen in die Reihe seiner anderen »Realismen« und »Nicht-Realismen«; im strikten Weitertreiben seiner frühen und immer geltenden Maxime: »Man muß alles in einem Film unterbringen«.
So dass wir am Ende von Notre Musique verführt sind, zu sagen: »Man konnte sehr weit sehen; aber nicht so weit, wie Godard (wieder mal) gegangen war«.
Das Film-Spiel mit einem Chandler-Roman spielt Godard hier nicht zum ersten Mal. In seinem Film Nouvelle Vague von 1990 hatte Godard seiner Hauptfigur, dem aus dem Nichts auftauchenden Alain Delon, den Namen Terry Lennox gegeben, der Hauptfigur aus Chandlers (nächstbestem) Roman The Long Good-Bye. Dort geht es darum, dass eine Person, die eigentlich tot zu sein hätte, aus ihrem »Jenseits« ganz kräftig die Lebenden aufmischt. Diesen Terry Lennox montiert Godard in den Anfang von Nouvelle Vague; dem Film, in dem ein toter Liebhaber – wir sahen ihn ertrinken –
erneut unter den Lebenden auftaucht: wo es in der Folge darum geht, wer von zwei Liebenden den andern jeweils ins Wasser stößt; und wer danach eine rettende Hand bietet (oder auch nicht); den Abschied also endgültig sein lässt.
Godards Filmproduktion zwischen 1990 und 2004 (die immer auch den möglichen Abschied vom Kino behandelt) finden wir aufgespannt zwischen zwei berühmte Chandler-Passagen. Der Film vom drohenden Untergang des Kinos (und vom drohenden Untergang der europäischen Zivilisation in geduldeten Gemetzeln à la Sarajewo oder Mostar), wird derart bei Godard zum film noir in Permanenz, heute.
In diesem Film Nouvelle Vague von 1990, mit dem Godard die späte Phase seiner Produktion einleitet – unter Verwendung des Schauspielers Alain Delon, der sein interessantes, unrasiertes Gesicht durch diesen Film trägt ohne einen der Sätze, die er darin sagt, wirklich verstehen zu müssen: z. B. »Was tun Sie hier?« »Ich errege Mitleid« – in dieser Neuauflage der Neuen Welle schält sich aus dem Stimmengewirr, gebaut wie ein Gesangsquartett in der Oper, der Satz: »Jetzt sollten wir wissen, was ein Bild ist. Denn wir haben viele Filme in der Brieftasche«.
Ja, wir haben viele Filme, viele Bücher, viele Gesichter, Namen und Vorfälle in der Brieftasche; aber, das unterstreichen solche Sätze, wir »wissen« immer noch nicht genau, was ein Bild ’ist’ – im Verhältnis zu einem anderen Bild oder zum »Wort«: dem gesprochenen Schauspielerwort, zum zitierten Literaturwort, zum Wort, das ins Bild geschrieben ist als Insert; zum Wort, das, schwankend oder in Erz gegossen, geschrieben steht in den Köpfen der Zuschauer.
Zweiter Film, Èloge d’amour.
Ehe man ein Bild sieht, hört man eine Stimme aus dem Off – es sei denn, man akzeptiert Schwarzfilm als Bild.[9] Eine sanfte Männerstimme spricht zu einer jungen Frau, die ins Bild kommt, Großaufnahme Gesicht frontal. Sie sitzt direkt vor der Kamera und spricht in diese hinein einen Satz, der mit der Erzählung des Mannes nichts zu tun hat: eine Aufforderung an »die Arbeitslosen«, sie sollten ihre Zeit nutzen zum endlich Nachdenken.
Die Männerstimme erzählt eine Episode aus früherer Zeit, etwas aus der Geschichte; Geschichte einer anderen früheren Frau, die gesagt hätte: »Dann nähte ich mir einen gelben Stern an«. Das geschah aus Solidarität mit ihrem Geliebten; eine Nicht-Jüdin also. Die deutschen Soldaten, unter deren Besatzung sich dies abspielte, 1942, reagierten: »Du willst Faschisten erleben? Das kannst du haben, und schlugen sie zusammen«. »Welch eine Zeit«, sagt das junge Mädchen im Bild. »Quelle Époche«. Schnitt. Schwarzfilm. Etwas anderes kommt ins Bild, nur auf der Tonspur ist die junge Frau noch vorhanden. Eine männliche Stimme fragt: »Wenn Sie wählen sollten zwischen Kino, Theater, Roman oder Oper, was würden Sie wählen?« »Vermutlich Roman«, antwortet ihre Stimme, etwas zögernd. Man sieht einen jungen Mann im Bild, der in einem Buch blättert. Das Buch ist geneigt zur Kamera, zum Zuschauer hin; es hat lauter weiße Seiten. Der junge Mann liest einen »Roman« aus leeren Seiten. Diese Seiten werden zu füllen sein vom Film; bis die Antwort auf dieselbe Frage am Ende des Films anders lauten wird.
Was wir nicht wissen: dass dies Gesicht damit aus dem Film auch schon verschwunden ist. Wir bekommen einige Zeit später mit, dass ein junger Mann aus dem Personal des Films namens Edgar »ein Projekt« hat; einen Film drehen will, für den er die passenden Schauspieler sucht. Alle Szenen von Èloge d’amour, die wir sehen, können Teil dieses Castings sein; und viele sind es auch; zwischen Personen der Filmhandlung und solchen Gecasteten gibt es keine Unterscheidung, und das bleibt so.
Nach dieser ersten Eröffnung, die die Frage nach der Konkurrenz der Genres und Medien beim Zugang zu Geschichtlichem aufwirft, folgt eine zweite. Wir sehen ein Frauengesicht, auch dies frontal in Großaufnahme und hören aus dem Off, dass dieser Film, der in seinem Titel »die Liebe« feiern will, vorhat, die Geschichte dreier Paare zu behandeln; eines jungen, eines erwachsenen und eines alten Paares; und dabei »die vier Momente der Liebe« zu entfalten. Wir sind gespannt, welche das sind. Die Stimme zählt auf: »Das Kennenlernen, die körperliche Liebe, die Trennung, das Wiederfinden«. Dieser Film, der das Lob der Liebe singen will, hält die Trennung für eins ihrer vier Grundelemente; Trennung allerdings als Voraussetzung des »Wiederfindens«.
Das Gesicht der Frau im Bild liefert eine Reflexion über die verschiedenen Lebensalter. Dass alle, die sich verändern wollen, die irgendwie weiterwachsen wollen, sich dabei von einem »Ich« trennen, das sie nicht mehr sind; dass sie dann, wenn sie ins Alter gekommen sind, die Zeit negieren, weil sie fürchten, von ihr ausgelöscht zu werden; dass sie stattdessen bestimmte »Erinnerungen« in ihrem Inneren installieren; und dass insgeheim der Gedanke bei ihnen bestehen bleibt, im Grunde immer dieselben geblieben zu sein. Auch diese Frau taucht später nicht wieder auf. Nur ihren Text werden wir wiederfinden, gesprochen von einer anderen Person. Das ist ein ausgestelltes Darstellungsmittel des Films; wir hören viele Texte doppelt. Sie gehören nicht einer bestimmten Person zu, und ändern damit ihre Bedeutung.
Dann ist da eine Gruppe von Leuten aus dem Kunstbetrieb, die damit beschäftigt ist, im Weltkrieg geraubte Kunst den jüdischen Besitzern zurückzuerstreiten. Frage: wem was rechtmäßig gehört. Das berührt eine zentrale Definition des Subjekts im Abendland. Es wird, rechtlich-ökonomisch definiert über den Besitz. »Ich besitze, also bin ich«. Außerdem prüft die Gruppe die Echtheit der Gemälde; Anwälte und Kunstexperten also, zwei Identitätsstifter der bürgerlichen Kultur. Identität: »Ich habe Rechte. Also bin ich. Ich besitze Kunst, also bin ich«; bzw. »Ich besaß Kunst«. Ich bin (aber auch) Jude. Ich bin Entrechteter. Ich bin Verfolgter. Ich »bin« in vielen der in Frage stehenden Fälle Ermordeter. Ich will meine Bilder zurück. Nein, ich habe Nachkommen. Diese wollen. Frage dahinter: Wem gehört Kunst? Man sieht keinen der Anspruchsteller im Film. Nur die Gruppe derer, die mit der Rückführung befasst ist. Sie sprechen über die aktuellen Unrechts-Besitzer der Bilder, Privatleute, Sammlungen, Unternehmen und Museen. Zitat: »Sie alle sind Diebe, auch der Louvre; mit dem Unterschied, dass der Direktor des Louvre die Nike von Samothrake nicht nur besitzen, sondern auch als ihr Schöpfer gelten will, neben Phidias«. Das ergibt eine schöne Identitätsbegründung: »Ich stehle, also bin ich«. Und nicht nur Besitzer, sondern Schöpfer (wenn ich Museumschef bin). »Ich habe Kunst (geklaut), also bin ich (Künstler)«.
Edgar, der junge Mann mit dem »Projekt«, gehört zu dieser Gruppe. Sein Film soll einer über »die Geschichte« sein und über die verschiedenen Altersstufen. Da alle Figuren des Films irgendein Alter ja tatsächlich haben, wird über alle Personen, die im Film auftauchen, ständig geredet im Sinne eines Casting; diese Sphären gehen ineinander über. Wir sehen eine junge Frau im Bild mit Hut und Kragen, wie aus einem niederländischen Gemälde des 17. Jhds., dann sehen wir sie ohne diese Klamotten, nur Kopf, Gesicht und Haare, und es wird, »für den Film«, das Gesicht »der Jugend«. Sie ist jung, sie ist schön. Aber nicht nur einfach jung, sie soll auch »die Jugend« sein in einem mythologischen Sinn, indem sie nämlich Eglantine »ist«, die jugendliche Geliebte des Parzival, eine Figur aus der Geschichte, aus der Literatur.
Mit dem Lebensabschnitt, der nach der Jugend kommt, hat der Film ein Problem. »Ein Junger ist ein Junger, ein Alter ist ein Alter«, hört man sagen, »aber was sind die dazwischen, die Erwachsenen?«. »Es gibt überhaupt keine Erwachsenen«, sagt jemand. Manchmal werden solche Sätze von jemandem gesprochen, der im Bild ist, einer Person also zuordenbar; manchmal von einer Stimme aus dem Off; die Kamera folgt nicht den redenden Personen. Wenn jemand aus dem Bild geht, behält die Kamera den gewählten Raumausschnitt bei; die Person, die außerhalb des Bilds weiterredet, kann weiter als »diese Person« verstanden werden; genauso aber kann die Stimme als eine Art Erzähler, Kommentator oder Reflektor aus dem Off genommen werden. Mit dem Resultat, dass Personen im Sinne von Charakteren im Film kaum entstehen. Der Film entwickelt einen bestimmten Diskurs, mehrere Diskurse, Liebe, Jugend, Alter, Politik, die Geschichte des Weltkriegs, Bilderraub, die Echtheit von Bildern, das Casting, die Weigerung, bestimmte Rollen zu spielen. Von einer Schauspielerin, die für eine Rolle in »Edgars Projekt« zur Debatte steht, wird gesagt: »Sie hat in dieser Fernsehserie gespielt; das spricht nicht für sie«. Antwort: »Sie hat sich geweigert, bestimmte Sätze zu sagen. Man hat sie rausgeschmissen. Die könnte was für uns sein«. Sehen tun wir sie nicht.
Die Szenerie dieses s/w-Films ist überwiegend ein Halbdunkel; die Personen meist im Halbprofil gefilmt; Schatten über Schatten. Viele Sätze der Personen werden mit dem Rücken zur Kamera gesprochen. Es gibt im ganzen Film nicht einen Dialog, der mit »Schuss/Gegenschuss« aufgenommen wäre.
Eine Frau, die Edgar besonders gern in seinem »Projekt« sähe, lehnt ab mit dem Satz: »Ich habe schon zu viele Leute aus diesem Geschäft gesehen«. Sie hat die Nase voll. Sie weigert sich beharrlich. Nebenbei erfährt man, dass ihre Eltern gemeinsam Selbstmord begangen haben, 1970, da war sie fünf Jahre alt. In Amsterdam, dort gibt es Leute, die einem bei so etwas helfen. Obwohl sie eine der Hauptfiguren der ersten Hälfte des Films ist, kennen wir kaum ihr Gesicht. Die Frau, alleinerziehende Mutter mit dreijährigem Sohn, lebt von Gelegenheitsjobs. Edgar sucht sie auf in einem Eisenbahndepot beim Waggonreinigen. Es ist früh morgens, es ist dunkel. Kaum hebt sich ihr Gesicht von diesem Dunkel ab. Und eigentlich sucht der mit dem Projekt auch gar keine Schauspielerin, sagt er, am liebsten wäre ihm jemand wie Simone Weil oder Hannah Arendt. Ihre Gesichter tauchen auf, als Bild; Gesichter für bestimmte historische Haltungen, die kein Schauspieler »mimen« kann.
Was ist ein Gesicht? Unklar. (Moritz Bleibtreu als Andreas Baader??)
In der Mitte von Éloge d’amour gibt es den Satz »Wir werden nie genau wissen, woraus ein Gedanke besteht«. Bergson wird zitiert und Charles Péguy, den Godard oft verwendet: »Wir können nur an etwas denken, indem wir an etwas anderes denken«. Heißt: wenn wir eine Landschaft sehen, können wir sie nur einordnen, also denken, indem wir sie mit einer anderen vergleichen, die wir gesehen haben. Im Filmbild dazu sehen wir ein Gewässer, einen städtischen Fluß, an dessen gemauerten Ufern wir eine frühmoderne Architektur erkennen. Wir denken nicht an »Landschaften« bei diesem Bild, sondern an andere Architekturen, die wir automatisch zu der im Bild in Beziehung setzen. Später hören wir denselben Gedanken noch mal zu einem anderen Bild. Aber keins dieser Bilder illustriert etwas aus den gesagten Sätzen.
Es gibt Passagen in dem Film, die dies Verfahren regelrecht demonstrieren. Etwa in folgendem erweiterten Selbstzitat aus Godards Film Vivre sa vie, dt. Die Geschichte der Nana S., 1963, der damit beginnt, dass ein Paar seine Trennung in einer Bar verhandelt. Wir sehen die beiden dabei von hinten, auf ihren Barhockern. Hier sind es Edgar und die Frau, die nicht in seinem Projekt sein will unter einer neuen Seinebrücke, über die Züge hinwegrauschen. Sie stehen im Bild mit dem Rücken zum Zuschauer; wir sehen die Graffitti am Brückenbeton, schäbig-moderne Hauswände, ihre hängenden Mäntel, eine Einstellung von ca. 4 min., an deren Ende die beiden über »Geschichte« sprechen.
»Ich glaube, Sie hatten recht. Die Amerikaner haben keine Vergangenheit«. »Die aus dem Norden. Die Mexikaner, die Brasilianer schon«. »Sie haben kein eigenes Gedächtnis. Ihre Maschinen haben, aber sie selbst nicht. Darum kaufen sie das Gedächtnis der anderen, vor allem derjenigen, die Widerstand geleistet haben. Oder sie verkaufen sprechende Bilder. Aber ein Bild sagt nie etwas…es müsste…aber nur das Nichts spricht daraus. Es ist nichts mehr zu sehen…aber genau das wollen sie«.[10]
Dass Godard den Wortsinn strikt von den Bildern trennte, war zuerst so in Schütze deine Rechte, 1986; der Film, der mit einem Telefonanruf beginnt, in welchem dem Idioten (= dem Filmemacher) mitgeteilt wird, man werde ihm verzeihen, wenn er unverzüglich mit seinem Film begänne und ihn am selben Abend fertig im Studio abliefere. Verzeihen aber nur, wenn er dies pünktlich erledige. Von seinem Vergehen erfährt man nichts; es muß sich um jenes handeln, überhaupt Filme zu machen. Im Bild sieht man keine Telefonierenden, sondern eine bewaldete Landschaft.
Textlich besteht Schütze deine Rechte fast nur aus Literaturzitaten, denen in den montierten Bildern nichts korrespondiert. Kein einziges der Filmbilder erläutert oder komplettiert einen der gesprochenen Texte; jedenfalls auf den ersten Blick nicht. Man muss den Film, wie alle späten Arbeiten Godards, mehrmals sehen, um mitzubekommen, dass uns hier, sehr kunstvoll, vorgeführt wird, wie »man« vernünftigerweise »Literatur verfilmt«; indem man nämlich den Wörtern einen eigenständigen Bilderstrom hinzufügt; z. B. verschiedene Formen des Verkehrs, Autos, Flugzeuge, Eisenbahnen. Bestimmte Bewegungsformen und -tempi werden zu Kommentaren oder Erläuterungen bestimmter Sätze aus Büchern; Godard selbst stolpert durch diesen Film als »der Idiot« (=der Filmemacher); pendelnd zwischen der Figur aus Dostojewski und einem Blödian mit Filmrollen unterm Arm, der die Studios belämmert im Versuch, diese dort zu verkaufen. Irgendwann hört man den Satz: »Das schwerste am Filmemachen ist, die Rollen herumzuschleppen«.
Der Film entfaltet sich zur schärfsten (und witzigsten) Verwerfung der sog. »Literaturverfilmungen«, dieses stupiden Umsetzens von Romanen im TV oder im Theater in »Dialoge« zwischen handelnden Personen, insbesondere auch des Filmemachens nach sog. »Drehbüchern«, die um »Charaktere« herum aufgebaut sind (dieser Kram, diese Personen-Buchhaltung, die man einreichen muß, um von staatlichen Filmförderungen Geld zu bekommen).[11]
Während Godard sagt, ja, Filmen beginnt vielleicht mit Texten, mit Büchern, mit Literatur, aber mit keiner, die man dann »bebildert«, die vielmehr etwas prinzipiell anderes sagt und will und kann, als das Bild; und diese Verschiedenheit und die mögliche gegenseitige Aufladung zu zeigen, sie zu bearbeiten, dazu ist Filmemachen (möglicherweise) da. Unter dieser Arbeitsvorgabe stehen alle Godardfilme seit spätestens 1990; und seitdem ist auch kein Godardfilm mehr in ein deutsches Kino gekommen.
Die neueren, Èloge d’amour oder Notre Musique, setzen diese Verfahren fort und verfeinern sie im weiteren Kreisen um das Verhältnis von Wort und Bild, von Denken (im Kopf) und zeigbaren Vorgängen des Denkens. Wort, Bild, Gedanken. Wie so oft bei Godard, und immer öfter, sieht man »Bilder, die mit Augen nicht zu sehen sind«. »Die Frau« da im Halbdunkel reinigt zwar auch Waggons in der Morgenfrühe im Eisenbahndepot. Sie putzt, während die Kamera eine langsam sich nähernde Lokomotive aufsaugt und durch die dunklen Gänge der Waggons späht, aber an ganz etwas anderem; und die Kamera zeichnet es auf. Sie putzt Erinnerungen an die Shoah weg. Wir sehen, in der Morgenfrühe, Waggonreinigen heißt immer noch, Blut abwaschen. Wir sehen das, obwohl Godard nicht irgendein »historisches« Bild dazu schneidet.[12] Es gibt, mit Ausnahme von ein paar alten Parisaufnahmen in denen de Gaulle-Plakate hängen, keine »historischen« Bilder in Éloge d’amour, wenn von vergangener Geschichte die Rede ist.
Die Bilder sind Jetztzeit; die Geschichte scheint aber durch. Es ist ein arabisches Lokal da beim Eisenbahndepot, in dem die jüdische Frau bei Nacht und Nebel lieber Eisenbahnwaggons putzt als in einem Geschichtsfilm mitzuspielen; die Frau, von der wir später hören werden, dass auch sie Selbstmord beging; wie ihre Eltern in Amsterdam.
Bis zu seiner 58. Minute ist der Film, der in die Geschichte des Weltkriegs und der Judenverfolgung reicht und der das Casting für »das Projekt« inszeniert, der also in der Jetztzeit spielt, aber von der Vergangenheit spricht, in s/w gedreht. Der Teil, der nun folgt, die letzte halbe Stunde, schneidet um auf Farbe. Zeitlich liegt dieser Teil, wie die Inserts betonen, zwei bis vier Jahre vor dem s/w-Teil. Seine Farbe ist allerdings die einer Hyper-Jetztzeit; nicht Farbe in TechnicColor. Die Bilder sind eingefärbt. Wir sehen das Blau des Meers mit Booten darin wie nur ein computergefärbtes Hyperblau sein kann. Die Bilder sind wie gemalt, aber nicht mit dem Pinsel, sondern Farbe aus modernsten Gerätetechnologien. Medienfarben.
»Die Amerikaner sind überall«, hieß es schon im 1. Teil; und daß man beim geplanten »Projekt« also keinen Liebesfilm drehen wolle von der Sorte Julia Roberts-Film (die im Gespräch zwischen den Franzosen französisch ausgesprochen wird, also Jülià Robèrte heißt.)
Hier nun, im Farbteil, treten die Amerikaner auf in Gestalt von Abgesandten der Steven Spielberg Studios. Sie sind in Frankreich, um den Stoff für einen Film über die französische Resistance einzukaufen. Das bringt das »Paar der Alten«, die Alten ins Spiel, die im Film bisher als jene Figuren vorkamen, die, in Decken gehüllt, auf Parkbänken oder in Bankeingängen herumliegen. Ein Alter im Film, dessen Personalität nicht enthüllt wird, fasst in einem dieser Glas- und Stahlambiente-Büros gegenüber einem jüngeren Befrager seine Situation zusammen in den Sätzen: »Ich frage mich, ob meine Zigarette bis zum Abend reicht. Ich frage mich, ob meine Schnürsenkel bis morgen halten. Ich frage mich, ob mein Atem bis nächste Woche reicht«; man sieht seine alte, schlurfige Gestalt nur in der Silhouette, sein Gesicht kaum; der junge Mann kehrt ihm den Rücken zu.
Nun die (bunten) Amerikaner und das gealterte Résistance-Paar. Die beiden, die Eheleute Bayard, haben 1941 eine Widerstandsgruppe »Tristan und Isolde« gegründet; so soll der Spielberg-Film über sie auch heißen. Godard variiert zunächst die Frage, ob die Amerikaner eine Geschichte hätten. Er variiert sie mit Witzen. Spielbergs Filmeinkäufer und seine schicke Sekretärin kommen angerauscht in einem superschicken Lotus Cabrio. »Oh, sagt Edgar bewundernd. Mein Vater kannte Colin Chapman, das ist der Erfinder dieses Wagens«. »So what«, sagt die Frau aus dem Auto indigniert und stapft aus dem Bild. Ihr verächtliches Schweigen sagt: »Ist doch scheißegal, wer den erfunden hat; ich fahre ihn. Und du Arsch weißt es und fährst ihn nicht« ‑ amerikanisches Dasein des triumphierenden Augenblicks. Schnitt, man sieht blaues Wasser, Felsen und hört die Stimme aus dem Off: »Sehr viel Sinn für Geschichte haben sie nicht, Madam«.
Die Spielberg-Gesandten zeigt Godard aktiv in der Szene des Vertragsabschlusses. Die Enkelin der beiden Alten überwacht den Vorgang; den Godard nicht anders als parodistisch zeigen kann: »Die junge Widerständlerin wird von Juliette Binoche gespielt, die kürzlich einen Oscar bekam«, diktiert der Spielberg-Anwalt. »Das Drehbuch verfasst der berühmte amerikanische Autor…«. »Halt, Einspruch, Euer Ehren«, unterbricht die Enkelin mit der Formel aus dem amerikanischen Gerichtsfilm. »Was für ein Amerikaner?« Der Amerikaner versteht nicht. Es gibt auch Südamerikaner? Ja, natürlich. Aber dieser ist Nordamerikaner! Das sind Kanadier auch, sagt sie. Also dann: Einwohner der Vereinigten Staaten. Das sind Brasilianer auch, sagt sie. Es gibt Mexikaner, Brasilianer usw. Wie heißen die Einwohner Ihres Landes? Er kann es nicht sagen. »Sie kommen aus einem Land, dessen Einwohner nicht sagen können, wie sie heißen…deshalb müssen sie Geschichten kaufen«[13] ‑ verbalen Slapstick kann Godard auch. »In allen heutigen Filmen müssen sich die Mädchen ausziehen und sich nackt auf ihrem Liebhaber herumwälzen«, moniert die Enkelin. Und aus dem Off kommt die Information: »Frau Schindler wurde nicht einmal bezahlt. Sie lebt heute verarmt in Argentinien«.
»Finde den Satz«; hört man jemand sagen am Ende des s/w-Teils. Wir haben gerade ein Plakat gesehen, in einer dunklen Passage, Pickpocket war darauf zu lesen; Titel des berühmtesten Films von Robert Bresson. Eine Art Liebes-Film auch das; wenn auch keine Liebesgeschichte. Erst im Knast erkennt die Hauptfigur, ein obsessiver junger Taschendieb, dass er in der falschen Spur lief. Das Mädchen Jeanne, das sich um seine sterbende Mutter gekümmert hat, während er Leuten die Taschen leerte, wäre der richtige Schatz gewesen, den »zu stehlen« gelohnt hätte. Er weiß es jetzt. Und wird entsprechend handeln, wenn der Knast ihn wieder ausspuckt. Éloge d’amour. Von irgendwoher fällt der Satz: »O Jeanne, welche Wege musste ich gehen, dich zu finden«. Er klammert den Ablauf dieser Sequenz zusammen und die vielen möglichen Wege »der Liebe«; aber nur, wenn man (zufällig oder nicht zufällig) weiß, dass das der Schlusssatz von Robert Bressons Pickpocket-Film ist.
»Wege der Liebe«, mehrdeutig, wie das Wort l’amour insgesamt in diesem Film. Es kommen zwar Paare vor, wie am Anfang versprochen, aber »Liebesgeschichten« zwischen diesen werden nicht gezeigt. Es ist von einer andern Art Liebe die Rede; das ist zuerst die Liebe zum Bild. Godard hat in früheren Filmen schon mit der Flaubert-Formel vom richtigen Wort – mot juste – gespielt, indem er abwandelte: »une image juste«, woraus dann wurde: »juste une image«. Einfach ein Bild, statt: genau das Bild, genau nur das Bild. Das richtige Bild gibt es nicht; es fällt einmal die Formulierung la chose juste im Film, das richtige Ding, die richtige Sache. Vom Bild her besteht nur die Chance, mit dem Verfahren »einfach ein Bild« sich »dem Ding« zu nähern; vielleicht etwas Genaues herzustellen; eine Sache, die etwas trifft. Ein kurzes Bild von einem Plattenspieler…die Nadel setzt auf…eine Männerstimme, zaghaft, sanft: Dein goldenes Haar, Margarete…die Stimme von Paul Celan…Godard hat nie aufgehört, Deutschlandfilme zu drehen…so wenig er aufgehört hat, America umzuwälzen in seinen Bildvorräten…in Èloge d’amour mit der Frage:
»Wann ist Ihrer Meinung nach der Blick gekippt?« Frage an Edgar; die junge Frau, die fragt ist nur von der Seite zu sehen; langes schwarzes Haar verdeckt ihr Gesicht. Durch die Glastür im Hintergrund sieht man das Gartengrün und goldene hängende Zweige. »Vor 10 Jahren? 15, 50? Vor dem Fernsehen, keine Ahnung«. »Genauer!« »Vor der Herrschaft des Fernsehens«. »Worüber?« »Vor dem Zeitgeschehen …oftmals sogar…« »…über das Leben?«…»Ja«. »Unser Blick erscheint mir heute wie ein kontrolliertes Programm, das subventioniert wird. Das Bild, mein Herr, allein fähig, das Nichts zu verneinen, ist auch der Blick des Nichts auf uns«. »Ich hoffe, nicht«.[14]
Es ist der Abschiedsdialog zwischen den beiden. Alles bricht auf. Ein Hubschrauber von schimmerndstem thyrrhenischen Plastikblau hebt ab; der dunkelgrüne Lotus der Spielbergs setzt sich in Bewegung. [15]
»Wann ist der Blick gekippt?«.Die Frage bleibt unbeantwortet. Bilder hatten mal mit »Wahrheit« zu tun. Ist es noch so? Es fällt der Satz: »Kann sein, die Wahrheit ist traurig«. Und Onkel Max (= Max Ophuls) wird zitiert mit dem Satz: »Das Glück ist nicht lustig«.
Ein »richtiges Bild« zum Ungeheuren zu finden« erst recht nicht. Da ist die Kosovo-Passage in Éloge d’amour. Man erfährt, dass es einen Vortrag gibt im Haus des Lexikons, von einem Amerikaner, Mark Hunter. Aus dem Off hören wir eine amerikanische Stimme, sie spricht leise von serbischen Greueltaten im Kosovo. Im Bild sehen wir ein Frauengesicht, allein, liegend auf rechter Hand, daran ein Ring. »Die Kosovo-Albaner in ihren Häusern wussten, dass die Serben sich an ihnen rächen würden, wenn die NATO Belgrad bombardieren würde«. Die amerikanische Stimme erzählt, wie Radio Belgrad diese Rache genehmigte. Sie zitiert den Bericht eines 12-jährigen Mädchens, das zusehen musste, wie vor seinen Augen 13 Menschen getötet und zerstückelt wurden, darunter ihre Eltern. Eine Stimme von Albanerseite ergänzt, dass zum ersten Mal in ihrer Geschichte Kosovo-Albaner ähnliche Verbrechen an Serben begangen hätten. Sie gehört dem Chefredakteur der albanischen Zeitung in Pristina. Er ist kurz im Bild. Mark Hunter, der den Vortrag hält, ist nicht im Bild. Ebensowenig irgendein >Dokumentarbild< aus dem Kosovo. Nur die Gesichter der Zuhörenden, die leise miteinander Kommentare tuscheln, während der Amerikaner spricht. Im Abspann des Films erscheint tatsächlich der Name Mark Hunter; wir haben also dessen Stimme gehört. Den Vortrag in Paris hat es gegeben. Die Massaker müssen wir imaginieren. Die leise, eindringliche Stimme suggeriert, dass sie »die Wahrheit« spricht.
Oder, noch einmal zum tanzenden Licht der Autoscheinwerfer, die wir zu sehen bekommen gegen Ende von Éloge d’amour; die Farbreflexe auf regennasser Windschutzscheibe, die man selbst nicht sieht. Von den Redenden sahen wir kein Gesicht. »Dialog« ist der Bezug der Lichtreflexe aufeinander. Sie negieren auf eine verspielte Art und Weise, dass den Wörtern die Hauptrolle auf der Bühne der Geschichte, die sie beanspruchen, zusteht. »Die Liebe zum Bild«, die Godard statt dessen ausstellt, codiert er (mit dem Wort eines Kirchenvaters) als maßlose. »Maßlos« ist sein Verfahren insofern, als es nichts ausschließt. Weder Bilder von mutigster Schönheit, noch solche von Kargheit, Schlichtheit & Dunkelheiten, in denen man (angeblich) kaum etwas sieht. Sowieso, sagt er, entsteht zwischen zwei montierten Bildern ein drittes Bild. Und zwar nicht nur in der Wahrnehmung des Zuschauers; es entsteht auch zwischen diesem Bild hier und den Bildern anderer Filme; wie die Einleitung von Notre Musique demonstrierte; und wie es Godards Montageverfahren in seinen Histoire(s) du cinéma durchgehend tun. Es gibt Bilder, die nach andern Bildern rufen. Aber nicht im Sinne von Reflexen (wie die Dokumentaristen oder Nachrichtenleute montieren), sondern im Sinne jenes Film-Denkens, das das Noch-nicht-Gedachte, das ist das Noch-nicht-Wahrgenommene oder auch das historisch Verdrängte Bild werden lässt; und sei es in Gestalt eines Stückchens Schwarzfilm.
Der Satz, dass wir »jetzt« wissen sollten, was ein Bild ist, da wir »so viele Filme in der Brieftasche haben«, ist nicht bloß ironisch, er ist im höchsten Maße selbstironisch und rücksichtslos offen. »Die Zeit der Sätze ist zu Ende«, heißt es an einer Stelle von Éloge d’àmour. Die Zeit der Liebe aber nicht. Nur: was ist die Liebe? Sie hat mit Bildern zu tun; aber das richtige Bild für sie gibt es nicht. Der bald 80-j. Godard scheut sich nicht, nach lebenslanger Arbeit am Film und mit Film, sich einzugestehen, dass er immer noch nicht sicher weiß, was ein Bild in seiner Daseinsform als montiertes, als geliebtes also, ist. Er glaubt etwas zu wissen vom Mangel der Wörter. Der besteht in ihrer behaupteten diskursiven Dominanz: Haupteingang in die Wohnung der Welt. Das Theater? Auf die Frage, ob er seine Idee mit dem Theater aufgegeben habe, antwortet der mit dem Projekt bündig: »Ja, ich habe es aufgegeben; sie brüllen da in einem fort«. Auf der Bühne werden Wörter gebrüllt. Sie führen nicht Bilder mit sich und sie führen nicht »zum Bild«.
Entschieden ist Godard auch in der Rolle der politischen Macht, der Macht des Staates: »Nichts steht der Liebe mehr entgegen als das Bild des Staates«. In Notre Musique heißt es: »Eine junge deutsche Katholikin schrieb 1943: Das Individuum will zwei sein. Der Staat will allein sein. Sie wurde geköpft« – eine weitere Hommage der späten Godardfilme an Sophie Scholl. Die besagt, es gibt auch böse Bilder. Die Bilder, die die Spielberg-Abgesandten machen wollen von dem alten Resistance-Paar sind nicht unbedingt »Bilder des Staates«, aber Bilder einer Diktatur:
Den Film, den die Spielbergs machen wollen, macht Godard dann unter der Hand selbst. Wir erfahren, dass der Alte die Rechte an seiner Story an Hollywood verkaufen will, weil er finanzielle Probleme hat. Dass die Story deswegen so interessant ist, weil es sich um die Geschichte eines Doppelagenten, eines irgendwie verordneten Verrats handelt; (Buchdeckel mit »Peter Cheney« drauf). Zum damit angespielten Verrat passt, dass der Alte im Film ziemlich genau aussieht wie der alte Ezra Pound; der Doppelagent für Mussolini und die Poesie. Über die Alte des Paars erfahren wir, dass sie in ihrem Bewusstsein immer noch zur Zeit der Resistance lebt; dass sie zwar gealtert, die Resistance aber jung geblieben sei: jetzt verkörpert in ihrer jungen frechen Enkelin, die die Hollywoodamerikaner in Verlegenheit bringt, weil sie ihre Nationalität nicht angeben können.
Und immer wieder sehen wir in diesen modernen, in den colorierten Teil das Insert „Archives“ eingeschnitten. Gerade das technisch neue, das computercolorierte Material, wird als Archivmaterial deklariert. Unter dem Punkt »Nationalitäten« wird dabei auch die Geschichte Frankreichs und der Bretagne kurz berührt; besonders ihre enge Verbindung zu England (»und damit auch zu Amerika«); u. a. mit dem leicht absurden Satz »Der halbe Shakespeare spielt ja in Frankreich«. Mit der Amerika-Neigung der Bretonen erlaubt Godard sich einen besonderen Scherz: Wir sehen zwei junge Mädchen von zehn, zwölf Jahren in bretonischer Tracht mit einer Unterschriftenliste. Wofür sie denn Unterschriften sammeln? Antwort: für eine bretonische Fassung von Matrix. Das sind die positiv-amerikanisierten Jungen: Amerika ist überall; selbst unter bretonischen Bollenhüten steckt es (als Keanu Reaves) in seiner besonderen Jung-Mädchen-Hirn-Gestalt.
Anders die junge Enkelin des Resistance-Paars. Sie hat andere Dinge gelernt und liest ihrer Großmutter Lehrsätze aus einem Kinolehrbuch vor: Robert Bressons Notizen zum Kinomategraphen. Hier fällt der Name Bresson, der im ersten Teil über Pickpocket nur anzitiert wurde. Einer der Sätze, die sie vorliest, lautet: »Alles was sich durch Schweigen und durch Dinge ausdrücken lässt, soll man durch Schweigen und durch Dinge ausdrücken« ‑ durch Bilder ohne Worte; also durch Umgang mit Licht, Lumières; das Wort, den Namen, den Godard nicht aufhört, zu beschwören. Ich traue mich aber zu sagen, dass auch das ein ironisches Zitat ist. Godard ist gerade nicht der Mann der schweigenden Bilder.
Und verzichtet auf »das Wort« keineswegs. Einer der schönste Momente von Notre Musique z. B.– es ist ein Nebenmoment, wie so viele – ist jener, wo der französische Botschafter in Sarajewo, der ein Bewunderer der Schriften von Hannah Arendt ist, zu deren Gesicht (ein Foto von ihr hängt in seinem Arbeitszimmer) lächelnd eine Bemerkung ihres Freundes Gershom Scholem zitiert: »Sie sieht aus wie zwölf Synagogen«. Und vor unserem Auge erscheint das Gesicht von Hannah Ahrendt, wie wir es nie wieder anders werden sehen können; als optische Inkarnation des Synagogischen; synonym für ihr spezifisches (unreligiöses) Jüdisch-Sein. Ein Wort-Bild, das haftet.
So wie kein einziges Gesicht einer Figur, einer »Person« aus Èloge d’amour haftet. In der Weise, wie noch 1990 das Gesicht und die Figur von Eddie Constantine Godards Film Allemagne Neuf Zero, Deutschland im Jahre Neu(n)-Null zusammenhält, gibt es keine Figur hier; keinen solchen »Charakter« in einem der späteren Filme Godards. Sie zeigen Gesichter, die etwas zeigen, was auf oder in diesem Gesicht selbst nicht ist. Die abwesende Schauspielerin wird gelobt, weil sie sich geweigert hat, in einer TV-Produktion blöde Sätze zu sprechen; das sagt genug. Ihr Bild brauchen wir dafür nicht.
Die Differenz Virtualität/Realität existiert dabei für Godard prinzipiell nicht.[16] Ob die Wörter, die die Realitätsbruchstücke instrumentieren und begleiten, aus dem Mund einer Person kommen oder einfach »aus dem Off«, macht ebenso keinen Unterschied. Wörter versuchen, sich der Dinge und der Bilder zu bemächtigen. Andererseits starten sie Ideen. Das italienische Kino wurde so groß, sagt jemand, weil »die Sprache Ovids und Vergils, Dantes und Leopardis in die Bilder eingegangen« ist.
Die Bilder, die einst die Kraft hatten, der Bemächtigung durch falsche Wörter zu widerstehen, haben diese Kraft aber verloren. Vielleicht durch die Bildwillkür und Bild-Geschwätzigkeit des Fernsehens, aber nicht sicher. Tragisch, was »die Jungen« dabei interessiert: eine Synch-Version von Matrix im eigenen Dialekt (Badisch. Berlinerisch. Plattdütsch). All diese Produktionen (»Hollywood« und seine Drehbuchfilme) lügen über die aktuelle Geschichte; den Zustand der europäischen Zivilisation angesichts ihrer Duldung des bosnischen Massakers und der tödlichen Gegenwart zwischen Palästinensern und Israel. Deren »Realität« man sich aber nicht nähern kann ohne den Weg durch Homer, durch Dante, durch Troia, Tel Aviv, die Westbank und durch »Winnetou«; den Weg durch die Körper radikaler feministischer Studentinnen auf Hochschul-Symposien und durch die geraubten jüdischen Vermögen und Gemälde von WW II.
Und: ‑ last not least, den Weg über Godards heimische Blumenkästen, die im Film so etwas wie sein Garten sind im Sinne Voltaires; und zugleich Friedhöfe für die Toten seiner Filme; wir bekommen sie zu sehen beim Bericht von »Olgas Tod«: »Olgas Grab«. Alles ist immer mehr als seine Oberfläche. Als würde alles von (mindestens) zwei Orten aus »gesehen« (und gedacht). Dazu bekommen wir, aus Godards Histoire(s) du cinéma, sogar ein Theorem: »Die Perspektive war die Erbsünde der abendländischen Malerei. Niepce und Lumière waren deren Erlöser«. Godards späte Filme sind Demonstrationen eines post-perspektivischen Sehens; besser noch eines unperspektivischen oder multi-perspektivischen: »Wenn wir eine Landschaft sehen, sehen wir mindestens zwei…wenn nicht zwanzig«…
Deswegen ergibt es sich für Godard am Schneidetisch, dass er Bilder nicht so aneinander schneidet, dass sie eine räumliche Orientierung ermöglichen, den Blick auf die Welt aus einem Zentrum; wohl aber eine imaginativ-historische; eine beschwörende Orientierung, möchte man sagen. »Jeder Film muss alles enthalten« ‑ d. h. nicht weniger, als das 19. Jhd./den Traum und seine Maschinerien, das 20. Jhd. und seine Kriege; und die Blicke des 21. Jhds. aus dezentrierender Digitalität. Éloge d’amour und Notre Musique sind Filme des 21. Jhds.; sie sehen mit Augen, die wir noch nicht haben; die wir gerade entwickeln, ohne es zu wissen oder zu bemerken. Wir werden Schichten sehen lernen mit einem neuen archäologischen Auge, das nicht »in den Raum« sieht und ihn dabei strukturiert; das vielmehr in »die Tiefe« und in alle Himmelsrichtungen zugleich sieht (‑ und hört).
Der tiefste (unerfüllte) Wunsch des seherischen Autors Georg Büchner, der Wunsch nach Aufsplitterung des eigenen Blicks, der Wunsch von Leonce oder Danton, sich selber auf den Kopf sehen zu können, »sich« dabei zu denken und zugleich die Schönheit der Welt aufzunehmen als Klang (liegend in Hängematten), ist heute wohl technische Wirklichkeit. Eine weitere Abteilung der Bilder, die mit Augen nicht zu sehen sind, ist bei Godard aufgemacht. Und auch hören tun wir nicht mehr nur mit dem Ohr.
»Dritter Körper…«
© Klaus Theweleit, Juni 2009
[2] Godard, 1995/9 , Bd. 3. S. 16f
[3] Anfang von Notre Musique, 10 min
[4] Notre Musique 0:36 – 0:40
[5] Koschnick legte sein Amt in Mostar nieder wegen mangelnder Unterstützung seiner Arbeit seitens der EU.
[6] Notre Musique 0:54 – 0:56
[7] Das sollte man im Sinn haben, wenn man Interviews mit JLG liest. Was da »steht« ist nicht unbedingt das, was er zu sagen unternahm.
[8] Notre Musique 0:42 – 0:48:35
[9]» Für den Rhythmus benutze ich schwarz«, Godard im Gespräch mit Youssef Ishaghpour
[10] Èloge d’amour 0:41:40 – 0:46 (in Kap. 11)
[11] Die Filmförderung Baden-Württemberg, sah ich kürzlich, wirbt für ihr aktuelles jährliches Drehbuchcamp mit dem Satz »Film beginnt mit Schreiben«; und meint damit Drehbücher, die eine Geschichte aufschreiben, von deren Personen und prämierten Dialogen aus die Dreharbeiten dann starten. Später kann die Geldvergabeinstitution prüfen, ob tatsächlich »dieses prämierte Drehbuch« verfilmt worden ist oder nicht.
[12] Èloge d’amour 0:20:59 – 0:25:48 (Kap. 6)
[13] Èloge d’amour 1:10:03 – 1:13:10 (Kap. 17)
[14] Èloge d’amour 1:17:45 – 1:19:45 (in Kap. 20)
[15] In seiner Bewunderungsmontage für Hitchcock in den Histoire(s) du cinéma, 4. Teil, feiert Godard Hitchcock als den Regisseur, »der die Welt kontrollierte durch Bilder«; Bilder, die erzeugt wurden und sich uns einprägen ohne Gewalt.
[16] „Wenn Fakten zur Legende werden, muss man der Legende gehorchen“, sagt einer der Experten in Èloge d’amour. Die Fiktion beseitigt die Realität, setzt sich an ihre Stelle, und wird selbst real. Diesen Vorgang zu bekämpfen, habe ich seit Jahren zu bekämpfen versucht in puncto »Reden, Schreiben, Filmen über die RAF«; natürlich vergeblich. Die RAF heute besteht nur noch aus Legenden; diese setzen sich durch; Baader, Meinhof, Ensslin: legendär festgeschrieben in der Rolle der für die 70er Jahre prototypischen guten Rebellen. Keine real-existierende Ikone etwa des Feminismus kommt dagegen an. Kein kämpferischer Ökologe, kein AKW-Verhinderer. Sie verschwinden in und hinter der RAF-Legende. So wie für mehrere deutsche Jahrhunderte das »deutsche Reich« weste in Kaiser Barbarossa in seinem Kyffhäuser; gegen jede Art von Wahrscheinlichkeit. 1933 dann sollten er und »das Reich« wiedergekommen sein in der Figur Hitler; hunderte Gemälde halten es fest. In der Koppelung mit Hitler als reinkarniertem Nibelungen ist Barbarossa dann mythologisch endgültig untergegangen. Die Legende starb; die mit ihr verkoppelten historischen Figuren leider nur teilweise. Wer kennt noch Barbarossa? Aber Hitler lebt. Für ihn ist die legendäre Abführfigur noch nicht gefunden.
***
Geschrieben in |  Keine Kommentare »
Keine Kommentare »